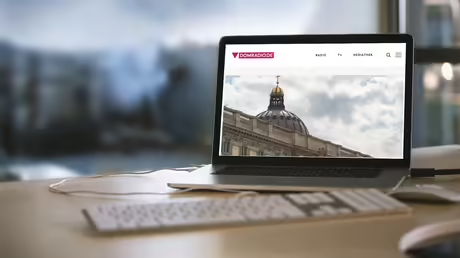Die Einladung Malikis ist ein Beweis für das Vertrauen in den Papst und in die vatikanische Diplomatie. Sie erinnert an die bewunderten Friedensbemühungen vom Winter 2003, als Johannes Paul II. einen Kriegsausbruch zu verhindern suchte. Dennoch erscheint die Einladung im Moment mehr als Geste der Höflichkeit, auf deren Annahme man in späteren, normaleren Zeiten hofft.
Denn wie schwierig der Vatikan die Situation im Irak derzeit einschätzt, lässt sich aus seiner Mitteilung über die Audienz von Benedikt XVI. vom Freitag für Maliki erschließen: Es gibt ein drängendes Flüchtlingsproblem. Zwei Millionen Iraker leben derzeit außerhalb des Landes, vor allem in den Nachbarstaaten Syrien und Jordanien; 2,7 Millionen Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht.
Die Flüchtlinge brauchten dringend Hilfe - "auch mit Blick auf eine erwünschte Rückkehr", heißt es in dem Text. Der Vatikan wiederholt damit sein Votum für eine Bewahrung der christlichen Präsenz im Irak. Zugleich schließt er andere Regelungen aber offenbar nicht (mehr) ganz aus.
Einbindung der Minderheiten
Eindringlich sprach der Papst seinen Gast auf die prekäre Situation der Christen im Irak an. Sie seien der täglichen Gewalt ganz besonders ausgesetzt. Und sie "fühlen sehr stark die Notwendigkeit einer größeren Sicherheit", lautete der unmissverständliche Appell zu stärkerer Unterstützung des Staates für diese Minderheit. Nach kirchlichen Angaben ist die Hälfte der irakischen Christen seit Kriegsbeginn 2003 geflohen. Im Süden ist für sie derzeit kaum eine Zukunft absehbar. Und die relative Sicherheit, die sie im Norden, vor allem im Kurdengebiet genießen, müsse mit auswärtiger Hilfe stabilisiert werden.
Der Papst ist überzeugt, dass ein Frieden und eine Zukunft im Irak ohne Einbindung der Minderheiten, vor allem der Christen, nicht möglich ist. Wenn man ihre religiöse Identität respektiere, könnten und würden sie zum Gemeinwohl und "zum moralischen und gesellschaftlichen Aufbau des Landes" beitragen, machte er im Gespräch mit Maliki deutlich.
Der Irak wie der gesamte Nahe und Mittlere Osten und vor allem die Situation der dortigen Christen steht ganz oben auf der Prioritätenliste der vatikanischen Diplomatie, wie auch die Audienz für Maliki zeigt. Denn während der Sommerzeit in Castelgandolfo empfängt der Papst nur in ganz besonderen Fällen Politiker zum Gespräch. Schon zuvor hatte es vatikanische Spitzengespräche über die Situation der Christen und Flüchtlinge gegeben.
Diplomatie statt Besuch
Ohnehin dürfte der Vatikan mit diplomatischer und karitativer Tätigkeit derzeit mehr erreichen als durch einen spektakulären Papstbesuch in Bagdad. Abgesehen von der Sicherheitsfrage bliebe das Problem einer unvermeidbaren politischen Instrumentalisierung. Daran war bereits das Besuchsprojekt vom Januar 2000 gescheitert.
Papst Johannes Paul II. wollte unbedingt eine Pilgerreise an Abrahams Geburtsort Ur unternehmen - letztlich waren aber alle anderen dagegen: Die Amerikaner wollten keine Aufwertung von Saddam Hussein durch den Papst. Hussein selbst feilschte monatelang mit den Vatikan-Unterhändlern über Programm- und Protokollfragen, um aus der Pilgerreise politisches Kapital zu schlagen. Und war letztlich doch gegen die Reise, weil der Vatikan sich darauf nicht weit genug einließ. Bagdad schob das US-Embargo und die Flugverbote vor - und sagte ab.
Ein Besuch ist wegen der politischen Lage aber unwahrscheinlich
Papst erneut in den Irak eingeladen
Schon einmal war ein Papst in den Irak
eingeladen: im Januar 2000, noch lange vor dem großen Krieg. Aber das Projekt scheiterte aus politischen Gründen. Jetzt hat Ministerpräsident Nuri el Maliki Benedikt XVI. eingeladen. Aber die dortige Lage ist trotz jüngster Verbesserungen noch weit von einer Normalität entfernt, die dem Papst die erforderliche Sicherheit und seinen Gläubigen die ungehinderte Begegnung mit ihrem Oberhaupt garantieren würde.
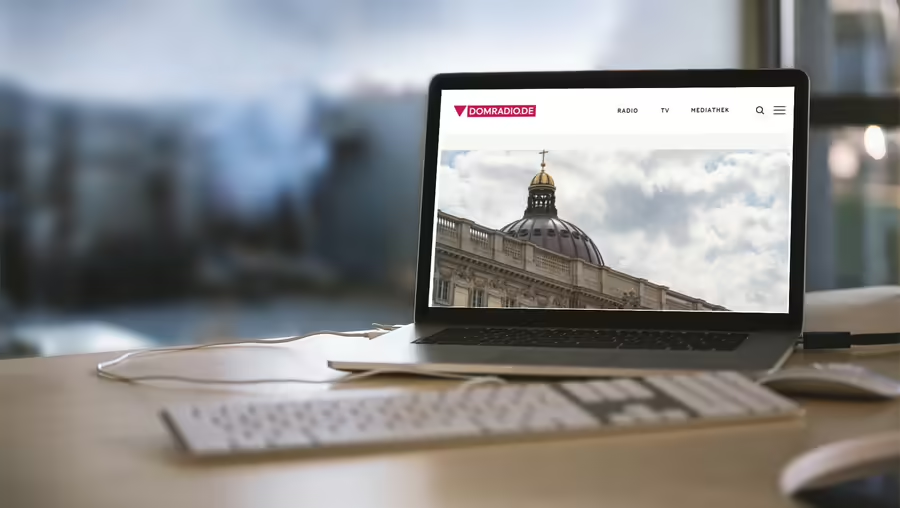
Share on