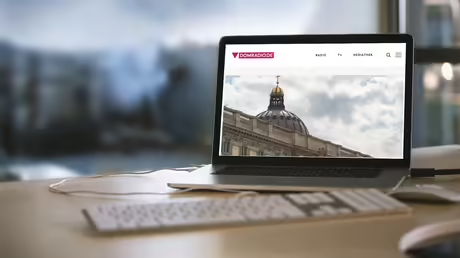Seit der Einführung der Sozialhilfe 1962 entschied die Politik über die Höhe der Regelsätze oft nach Kassenlage. Daran hat sich bis heute nichts geändert, kritisieren die Wohlfahrtsverbände. Jürgen Borchert, Sozialrichter aus Darmstadt, legt den Finger in die Wunde, wenn er mangelnde Transparenz beklagt. Über das Existenzminimum sei "niemals in öffentlicher, parlamentarischer Debatte entschieden worden." Borchert war einer der Initiatoren des Bundesverfassungsgerichtsurteils zu Hartz IV, das 2011 zu neuen Hartz-IV-Regelsätzen führen muss.
Die Karlsruher Richter hatten im Februar die Hartz-IV-Sätze als verfassungswidrig verworfen und eine "transparente und nachvollziehbare" Neuberechnung verlangt. Dem kam Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) nach: Der Regelsatz für Erwachsene soll um fünf auf 364 Euro steigen. Seit dem tobt der Streit darüber, ob die Erhöhung angemessen ist, ob die Berechnungen korrekt sind und ob Tabak und Alkohol zum Existenzminimum gehören.
Einer, der der Bundesregierung ein abgekartetes Spiel vorwirft, ist Uwe Becker. Die Neuberechnung der Regelsätze sei "fragwürdig und politisch gesteuert", sagt der Vorsitzende der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. Sie erfülle nicht die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Dagegen seien die jüngst auf Basis einer Studie von der Diakonie ermittelten Regelsätze nachvollziehbar, transparent und "gerichtsfest". Mindestens 433 Euro seien demnach für einen Erwachsenen zu bezahlen.
Ein roter Faden durch die bundesdeutsche Armutspolitik
Solche Auseinandersetzungen ziehen sich seit den 60er Jahren wie ein roter Faden durch die bundesdeutsche Armutspolitik. Dabei werden nicht nur neue Schlachten geschlagen: Schon bei der Einführung der Sozialhilfe 1962 wurde Bedürftigen Geld für 50 Gramm Tabak pro Monat zugestanden - ein echter Aufreger für Teile der Bevölkerung.
Zuständig für die akribische Zusammenstellung des sogenannten Warenkorbes war der noch heute bestehende "Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge" (Berlin), ein Verbund aus Kommunal- und Wohlfahrtverbänden. Dessen Experten ermittelten die Ausgaben des täglichen Bedarfs sowie die Kosten für Lebensmittel für den "Regelsatz". Sozialhilfeempfänger erhielten unter anderem zwei Rosshaarbesen und eine Glühbirne im Jahr sowie zum Beispiel alle zwei Monate eine Kino- oder Theaterkarte. Ferner pro Monat sechs Fahrkarten für Bus oder Straßenbahn, 70 Gramm Kalbfleisch, 1/8 Liter Sahne sowie drei Flaschen Bier. Und täglich ein halbes Ei.
Dass Länder und Kommunen den Warenkorb in den 70er Jahren nicht ständig an die veränderten Konsumgewohnheiten anpassten, rief immer wieder Kritiker auf den Plan, die darin eine Kürzung durch die Hintertür sahen. Aus Angst vor steigenden Kosten passten die Experten "den Korb einfach an die Preise an", so Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Ergebnis: Bedürftige konnten sich meist nur Billigprodukte statt Markenwaren leisten.
"In Hinterzimmern und Kungelrunden ausgemacht"
1981 stellte der Deutsche Verein zwar eine zeitgemäßere Produktpalette zusammen, wonach die Regelsätze um 30 Prozent hätten steigen müssen. Stattdessen booteten die Finanz- und Innenminister den Deutschen Verein aus und setzten eine eigene Arbeitsgruppe ein. Die prüfte und rechnete mit spitzer Feder, doch das Ergebnis war den Ministern noch immer unbezahlbar: Nach heutigen Preisen wären Kosten von 250 Millionen Euro auf die Gemeinden zugekommen.
Einen Ausweg aus der Misere versprach das "Statistikmodells", das 1989 den Warenkorb ersetzen und sich nicht mehr am Standard des tatsächlichen Mindestbedarf der Menschen orientieren sollte. Die Regelsätze wurden danach festgesetzt, was einkommensschwache Haushalte als Vergleichsgruppe im Monat ausgeben und wofür sie es tun. "Ethik und Nachdenklichkeit wurden durch bloße Statistik ersetzt", urteilt Schneider und nimmt Anstoß daran, dass dieses Verfahren kaum noch zu durchschauen ist.
Ein Vorwurf, der bis heute nicht verstummt ist, wie Sozialrichter Borchert bestätigt. Das Existenzminimum wurde "quasi immer in Hinterzimmern und Kungelrunden ausgemacht, in denen der Finanzminister dann das letzte Sagen hatte".
Seit fast 50 Jahren streiten Politiker, was der Staat Armen geben soll – 2010 besonders
Eine halbe Kinokarte im Monat
Die Frage, was der Staat seinen mittellosen Bürgern zu geben hat, sollte eigentlich leicht zu beantworten sein. Ein Blick ins Grundgesetz genügt. Bedürftige müssen finanziell so ausgestattet werden, dass sie in Würde leben können. Aber wer definiert dieses Existenzminimum? Und wie öffentlich muss das Verfahren sein?
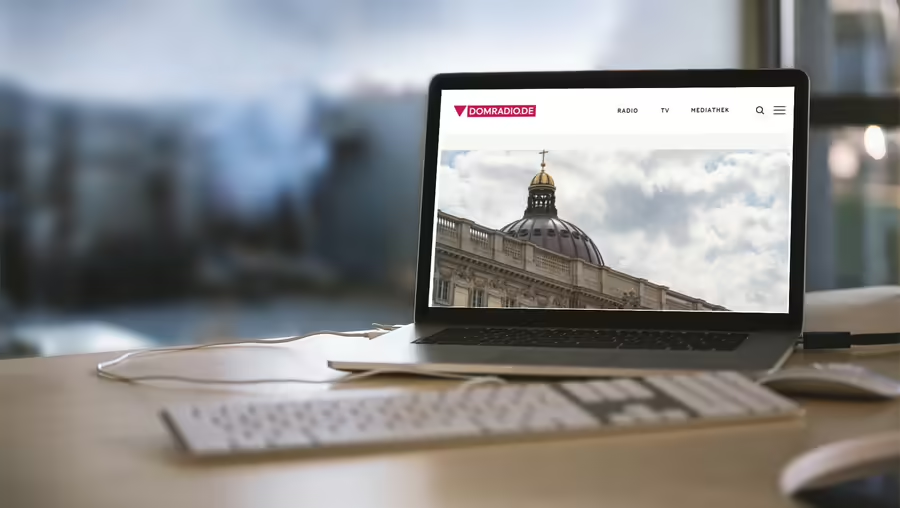
Share on