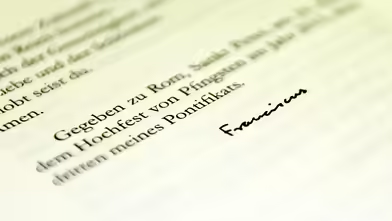An der tiefsten Stelle der Weltmeere haben Forscher kürzlich Plastik entdeckt. Für manche Korallenriffe könnte laut Experten jede Hilfe zu spät kommen. Die Situation der Meere ist dramatisch - obwohl kaum jemand sich der Faszination des offenen Wassers entziehen kann. Und obwohl immer mehr Menschen die Entwicklung mit Sorge beobachten.
Zum Welttag der Ozeane, der am Samstag zum zehnten Mal stattfindet, schlagen Forscher und Helfer Alarm.
Die Probleme sind für die meisten unsichtbar
Plakative Bilder erregen Aufmerksamkeit - und haben zuletzt die Debatte um Plastikmüll befeuert. "Die Vermüllung am Strand, verendende Seevögel - das alles ist gut sichtbar und bewegt die Menschen", sagt die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, Beate Jessel. "Schwieriger ist es mit eher abstrakten, schleichenden Entwicklungen."
Lutz Möller, stellvertretender Generalsekretär der Deutschen Unesco-Kommission (DUK), sieht es ähnlich. "Viele Probleme der Ozeane sind für die allgemeine Öffentlichkeit eher unsichtbar und wenig anschaulich", erklärt er. So werden die Meere nicht nur durch Plastik verschmutzt, sondern auch durch unsichtbare Gifte, Schwermetalle und Nährstoffe. Lebensräume werden zerstört, natürliche Ressourcen abgebaut. Die entscheidende Herausforderung sei jedoch der Klimawandel mit seinen Folgen.
Die Bremse an der Welttemperatur
Die Ozeane nehmen 30 bis 40 Prozent des vom Menschen ausgestoßenen CO2 auf. Dieser Stoff wirkt im Wasser gelöst als Säure - was die Meere nach und nach versauern lässt. Zugleich nehmen die Ozeane 90 Prozent der Wärme auf, die durch die Erderwärmung entsteht, weshalb der Sauerstoffgehalt sinkt. "Ohne die Ozeane wäre die Welttemperatur schon viel stärker gestiegen", erklärt Möller. "So sehr die Ozeane auch betroffen sind, sie leisten für uns Menschen einen unersetzbaren Dienst."
Unter der Kombination aus Versauerung und steigender Oberflächentemperatur der Ozeane leiden indes zahllose Wasserwesen wie Fische, Seevögel, Säugetiere; insbesondere aber Tiere mit Kalkschalen wie Korallen.
Ein weiteres Problem ist die Überfischung. "Nur bei sieben Prozent aller Fischbestände könnten wir die Fangmenge theoretisch noch etwas steigern", sagt Möller.
Das hat wirtschaftlich-soziale Folgen: Die früher sehr reichhaltigen Fischgründe vor Westafrika zum Beispiel werfen heute kaum noch Erträge ab - laut Möller insbesondere "aufgrund asiatischer Flotten. Die Fischer in Westafrika können kaum noch genug zum eigenen Überleben fangen; auf die afrikanischen Märkte drängt dafür gefrorener Billigfisch, der aus den afrikanischen Meeren über den Umweg Ostasien zurückkommt."
Zudem befeuert die Überfischung das Artensterben, auf das der Weltbiodiversitätsrat kürzlich in einem Bericht aufmerksam machte.
Demnach gibt es heute weltweit 20 Prozent weniger Arten als zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Mehr als 40 Prozent der Amphibienarten, fast 33 Prozent der Korallen und mehr als ein Drittel aller Säugetierarten im Meer seien bedroht.
Lob für private Bemühungen
Angesichts solcher Entwicklungen meinen manche Beobachter, private Bemühungen seien ein Tropfen auf den heißen Stein. Trotzdem sammeln viele Menschen am Urlaubsstrand zurückgelassenen Müll, versuchen Plastik zu vermeiden - oder demonstrieren für mehr Umweltschutz. Aus Möllers Sicht ist dieser politische Einsatz der entscheidende Hebel.
"Es ist nicht der richtige Weg, über Verbote jede Form der Lust am Leben und des Genusses zu nehmen; es geht um Steuerung, etwa um Bepreisung von Umweltfolgen", sagt er etwa im Hinblick auf zunehmenden Kreuzfahrt-Tourismus, den manche Fachleute als weiteren Todesstoß für die Ozeane betrachten.
Der DUK-Vertreter hält nichts davon, alle Verantwortung auf den Konsumenten abzuwälzen. "Für die großen Lösungen braucht es politische Entscheidungen und Gesetze - und dafür politische Mehrheiten", sagt er. Organisationen wie Greenpeace fordern etwa Schutzgebiete, damit Lebensräume im Meer wieder aufgebaut werden können.
Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) wies zuletzt darauf hin, dass etwa ein UN-Seerechtsübereinkommen von 1982, das Überfischung durch unkontrollierte Fischerei verhindern soll, zu wenig beachtet werde. Nötig wäre laut bpb vor allem, "existierende Vereinbarungen durchzusetzen".