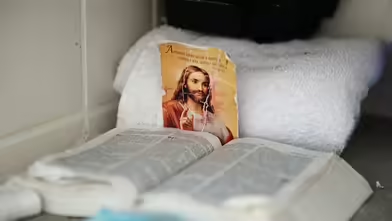Wenn Bischof Antonio Ablon morgens aufwacht, dann ist er mit den Gedanken in seiner philippinischen Heimat: "Was ist wohl heute wieder Schlimmes passiert?", fragt er sich Tag für Tag. Wegen seines Einsatzes für verschiedene Minderheiten und seiner Kritik an der philippinischen Regierung hatte der 47-jährige Geistliche Morddrohungen erhalten. Seit gut einem Jahr lebt er im Exil in Hamburg.
Ablon ist Bischof der Unabhängigen Philippinischen Kirche (Iglesia Filipina Independiente), einer 1902 aus der katholischen Kirche heraus gegründeten Gemeinschaft mit rund drei Millionen Mitgliedern.
Seine Diözese liegt auf der Insel Mindanao im Süden des Landes. Die Region gilt seit Langem als Unruheprovinz.
Der seit 2016 amtierende philippinische Präsident Rodrigo Duterte geht auch dort mit zunehmender Härte gegen Oppositionelle vor. Unter dem Deckmantel eines "Anti-Drogenkriegs" lässt er nicht nur Kriminelle, sondern auch Kritiker und Menschenrechtsaktivisten verfolgen und ermorden. Der Internationale Strafgerichtshof ermittelt wegen möglicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Ablon war schon als Student politisch aktiv
Ablon nahm schon während seiner Studienzeit an Demonstrationen teil und unterstützte Menschenrechtsorganisationen. "Ich lese das Evangelium immer im Licht der gesellschaftlichen Entwicklung und verstehe es als Aufforderung zum Handeln", schildert er seine Motivation. Nach seiner Priesterweihe 1999 verstärkte er sein Engagement. 2006 erreichte ihn erstmals eine Morddrohung per SMS.
"Ich wurde als Sprachrohr der Guerilla dargestellt. Dabei ist alles, was ich getan habe, für die Ausgegrenzten, die Armen, die Bauern, die Arbeiter, die Eingeborenen und andere Opfer des Regimes zu sprechen."
Aufgeben kam für Ablon nicht infrage. Als er 2010 Bischof wurde, begann er, sich verstärkt für die Rechte der indigenen Bevölkerungsgruppe der Lumad einzusetzen, die für den Abbau von Bodenschätzen immer wieder durch das Militär von ihrem Land vertrieben werden. Die Behörden forderten ihn immer nachdrücklicher dazu auf, dieses Engagement einzustellen; zahlreiche seiner Mitstreiter wurden ermordet. Schließlich tauchte auch Ablons Name auf öffentlichen Mauern auf - in roten Lettern, um ihn als Kommunisten und Terroristen zu diffamieren. "Viele andere, die auf diese Weise gebrandmarkt wurden, wurden wenig später tot aufgefunden."
Einladung aus Hamburg
Auch wenn er allen Grund hätte, in Tränen auszubrechen, erzählt Ablon von den Ereignissen mit überraschender Leichtigkeit. "Wir Filipinos haben die Angewohnheit, auch schwere Geschichten immer mit einem Lächeln zu erzählen", erklärt er. Weil der Druck auf den Bischof immer größer wurde, lud ihn ein Freund ein, eine Zeit lang nach Hamburg zu kommen. "Ich war unheimlich dankbar, dass ich einmal durchatmen konnte", sagt Ablon rückblickend. Und: "Eigentlich wollte ich nur drei Monate bleiben." Doch Mitstreiter und seine Kirche rieten ihm von einer Rückkehr in die Heimat ab. "Sie befürchteten, dass Dutertes Truppen mich schon am Flughafen erwarten und ausschalten könnten." Inzwischen ist Ablon Gast der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte und darf noch mindestens bis November in Deutschland bleiben.
Bis heute plagen den Exil-Bischof Schuldgefühle, dass er die Opfer des Duterte-Regimes im Stich lässt. Auch die Sehnsucht nach seiner Frau und seinen 19 und 22 Jahre alten Söhnen, die seiner Einschätzung nach zwar in Sicherheit sind, aber weiter auf Mindanao leben, ist groß. "Auf der anderen Seite merke ich, dass ich meinen Leuten auch aus der Ferne helfen kann."
Ablon erzählt von seiner Geschichte
Ablon reist durch Deutschland und Europa, um seine Geschichte zu erzählen. Er knüpfte Kontakte zum UN-Menschenrechtsrat in Genf und ist inzwischen Koordinator eines europäischen Netzwerks für Gerechtigkeit und Frieden auf den Philippinen. Aktuell beteiligt er sich an einer Kampagne der Körber-Stiftung "Neues Leben im Exil", die auf das Schicksal politisch Verfolgter aufmerksam macht.
Glaubt er noch an Veränderung auf den Philippinen? "Ich bin von der Kirche, ich habe immer Hoffnung", sagt Ablon, der immer noch lächelt. Die Menschen müssten realisieren, welche Macht sie haben, meint er. "Es ist nicht der Präsident, der die Gesellschaft verändert, sondern die Gesellschaft verändert sich selbst." Was seine Rückkehr auf die Philippinen angeht, macht er sich jedoch spätestens seit Inkrafttreten des Anti-Terrorismus-Gesetzes im Juli, das Präsident Duterte weitreichende Rechte im Kampf gegen Dissidenten einräumt, keine Illusionen. Zum ersten Mal im Gespräch stockt seine Stimme: "Den Tag, an dem ich jemals wieder einen Fuß auf die Philippinen setzen werde, sehe ich im Moment nicht."