Neben dem Werk William Shakespeares waren es die Dramen Friedrich Schillers, mit denen sich der italienische Komponist Giuseppe Verdi zeit seines Lebens auseinandergesetzt hat: Nach „Giovanna d´Arco“ („Die Jungfrau von Orléans“), „I masnadieri“ („Die Räuber“) und „Luisa Miller“ („Kabale und Liebe“) bildet der 1867 in Paris uraufgeführte „Don Carlo“ den Abschluss der Auseinandersetzung mit den Dramen Schillers. Dabei konzentrierten Verdis Librettisten Joseph Méry und Camille du Locle das dramatische Geschehen der Vorlage stärker auf die seelischen Konflikte der Protagonisten. Schillers Helden müssen den Widerspruch zwischen privatem Gefühl und Staatsräson erfahren. Hier setzt auch Verdi an: Die Partitur des „Don Carlo“ zeigt die Entwicklung von den frühen Nummernopern zu den durchkomponierten Musikdramen des Spätstils. An die Stelle des üblichen Arientyps tritt die dramatische Soloszene, in der die Protagonisten ihre Situation reflektieren: Das Scheitern des Einzelnen bei dem Versuch, seine politische bzw. gesellschaftliche Position mit seinem privaten Leben in Einklang zu bringen, findet hier seinen entsprechenden Ausdruck. Die politische Dimension des Librettos zeigt sich sowohl in den Szenen der Hauptfiguren, als auch in der neu erfundenen Szene des Autodafés und in der spannungsgeladenen Konfrontation des Königs Philipp II. mit dem Großinquisitor.
Von Guiseppe Verdi
Don Carlos
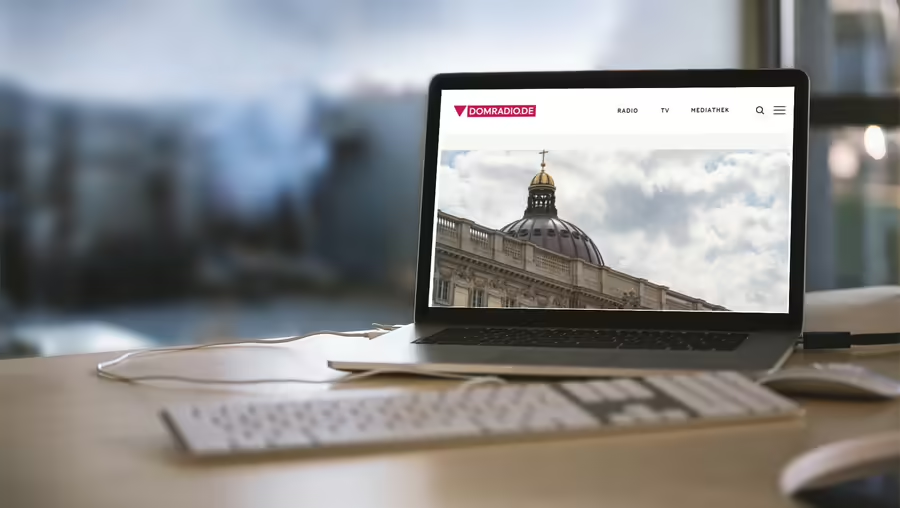
Share on
