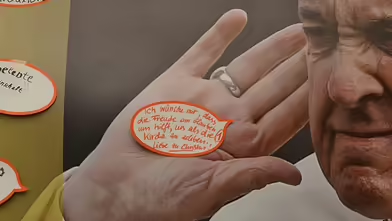DOMRADIO.DE: Warum ist diese Predigt für die Ausstellung "75 Jahre NRW" so interessant aus Ihrer Sicht?
Dr. Ulrich Helbach (Leiter des Historischen Archivs des Erzbistums Köln): Am Anfang der Landesgründung standen natürlich Not und Elend. Der Krieg war ein Jahr zu Ende. Die Infrastruktur und die Versorgung lagen darnieder. Schuldfragen lagen über dem Land und es gab auch keine deutsche Zentralregierung – also ein gewisses Vakuum. Niemand außer den Briten in NRW konnte dann letztlich für die Versorgung eintreten.
Das kulminierte dann in der Not des Winters in einem Engpass in der Energieversorgung. Und letztlich ist das dann zu einem Mythos geworden: Diese Predigt ist ein Beispiel für diese enorme Notlage am Anfang der NRW-Geschichte.
DOMRADIO.DE: Kardinal Frings hat diese Predigt an Silvester 1946 gar nicht im Kölner Dom gehalten, sondern in St. Engelbert in Köln-Riehl. Warum eigentlich?
Helbach: Auch das geht ganz klar auf den Hintergrund des Krieges zurück. Der Dom war im Inneren so stark zerstört. Er ist erst 1948 notdürftig wiederhergestellt gewesen, sodass man da damals keinen Gottesdienst halten konnte.
DOMRADIO.DE: Was hat denn der Kardinal damals gesagt, dass sich das derart stark eingebrannt hat?
Helbach: Nun, er hat etwas gesagt, das an sich inhaltlich nichts völlig Neues war. Aber das man das offen sagte, in so einer Situation ... Ungefähr ist in dem Manuskript wiedergegeben: In Zeiten wie den unsrigen, so sagte er in etwa, darf der Einzelne in der Not sich das nehmen, was er zur Erhaltung des Lebens und der Gesundheit notwendig hat, wenn er es durch Arbeit oder Bitten oder Betteln nicht erlangen kann.
Das ist ja die Morallehre der katholischen Kirche gewesen, Stichwort Mundraub. Aber dass man diese Botschaft dann in der Situation so sagt, ist dann zum Politikum geworden.
DOMRADIO.DE: Also es war im Grunde – ganz platt – der Segen zum Stehlen. Haben die Leute dann tatsächlich auch angefangen, vermehrt zu "fringsen"?
Helbach: Sie hatten das vorher im Grunde schon getan. Man kennt ja dieses Stichwort: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Sie hatten es im Krieg tun müssen zur Erhaltung des Lebens. Sie haben es in der Not nach dem Krieg getan, als die Infrastruktur ganz mies war.
Die Diebstähle haben einerseits natürlich zugenommen, andererseits sind aber, das darf man nicht unterschätzen, viele Menschen, die so etwas nicht gewohnt waren, die es aber gleichwohl getan hatten, erleichtert worden in ihrem Gewissen. Es hat ihre eigene Gewissensnot ein Stück weit genommen. Und auch das hat sehr stark zur Popularisierung der Botschaft beigetragen.
DOMRADIO.DE: Kardinal Frings hatte hinterher gesagt: Wenn er gewusst hätte, was seine Worte bewirken, dann hätte er sich anders ausgedrückt. Was wollte er denn eigentlich sagen?
Helbach: Einerseits wollte er durchaus zuspitzen. Er war im Grunde sauer, kann man sagen. Er hatte im Sommer schon die Welle von Not durch die fehlende Energieversorgung vorhergesehen. Er hat das bei den Briten angemahnt. Sie sollten auch gefälligst die Kohle-Transporte, die in einer gewissen Menge ins Ausland gingen, zur Versorgung der eigenen Notlage, die sollten sie doch in den Kältewochen einstellen. Die haben ihn auflaufen lassen.
Insofern hat er so ein bisschen dieses Verschulden der Not für sich selbst auf die Briten geschoben und hat das dann auch so deutlich und so krass gesagt. Aber er ist nachher erschrocken gewesen über die Popularisierung seiner Worte. Er war ja ein junger Bischof, vier Jahre im Amt, noch keine fünfzig Jahre alt. Man hat ihm ja nachher vorgehalten, er habe den Diebstahl förmlich gebilligt. Das hat er natürlich so pauschal nicht getan. Und überhaupt, wenn er sich auf die Kanzel stellt und so etwas gesellschaftspolitisch Relevantes sagt, dass er da so polarisierende Wirkung erzeugt, dass das hat ihn erschrocken.
Im Grunde war es ein Aufruf an den Staat, einen gewissen Ausgleich zu schaffen in der Not zwischen den Verarmten und den Wohlhabenden. Das steht da durchaus hinter, und das hat er auch in der Predigt gesagt. Aber diesen Teil der Predigt, der auch heute wieder aktuell ist, hat man dann gar nicht so transportiert. Aber es ist stehen geblieben: Ziviler Ungehorsam, Gewissenserleichterung, ein gewisses Wir-Gefühl und das muss man auch sagen, eine gewisse Ansprache an die soziale und nationale Identität der Bevölkerung gegenüber der Militärregierung, den Besatzern. So hießen sie ja damals immer noch, obwohl sie unser Land befreit hatten. Das alles ist in einem Satz kulminiert und als Mythos dann gewachsen.
Das Interview führte Tobias Fricke.