Gerade die Erinnerungs- und Bildungsarbeit in Schulen, Museen und Gedenkstätten sei Ausdruck der Verantwortung gegenüber den Opfern, betonte der Ministerpräsident. Jungen Menschen müssten Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde Werte sein, für die sie eintreten. Dabei hätten Orte wie die KZ-Gedenkstätte Dachau mit ihren jährlich rund 400.000 jugendlichen Besuchern besondere Bedeutung.
Aus Münchner Zuchthäusern verschleppten die Nazis am 22. März vor 75 Jahren politische Häftlinge in eine leerstehende Munitionsfabrik nach Dachau. Damit sei, wie KZ-Gedenkstättenleiterin Barbara Distel sagt, auf zunächst ganz unspektakuläre Weise die Keimzelle des «Terrorinstruments» des KZ-Systems geschaffen worden. Auf einer Pressekonferenz in München hatte der SS-Reichsführer und Münchner Polizeipräsident Heinrich Himmler angekündigt, dass in der oberbayerischen Kleinstadt Dachau vor den Toren Münchens das erste Konzentrationslager in Bayern entstehen sollte.
In dem KZ-Dachau, das zum Modell für alle weiteren Konzentrationslager wurde, sollten Himmler zufolge die gesamten kommunistischen Funktionäre und Oppositionspolitiker, die «die Sicherheit des Staates gefährden» könnten, «zusammengezogen» werden. Bis Kriegsende hielt die SS hier über 200.000 Menschen gefangen und ermordete mindestens 40.000. Am 29. April 1945 befreiten US-Truppen das KZ Dachau.
Die «Disziplinar- und Strafordnung», die der zweite Kommandant und spätere KZ-Inspekteur Theodor Eicke am 1. Oktober 1933 in kraft setzte, gab der Schikane, der Folter und dem willkürlichen Mord in Dachau den Anstrich eines geregelten Strafsystems. Jedes Fehlverhalten war mit drakonischen Strafen belegt: Arrest, Stockhiebe, Pfahlhängen, Exekution. Die Häftlinge lebten in ständiger Todesangst.
Das KZ Dachau war für 6.000 Häftlinge ausgerichtet. Bis Kriegsbeginn waren hier vor allem Kommunisten, Sozialdemokraten und Juden inhaftiert. Später kamen Tschechen, Polen und Russen hinzu. Eine große Gruppe stellten auch die 2.720 Geistlichen des Pfarrerblocks. Tagsüber arbeiteten die Häftlinge im Straßenbau, in der Kiesgrube, auf der Plantage oder für den Rüstungsbetrieb.
Der Arbeitseinsatz sollte laut Anweisung des SS-Wirtschafts- Verwaltungshauptamts «im wahren Sinn des Wortes erschöpfend sein, um ein Höchstmaß an Leistung zu erreichen», die Arbeitszeiten waren «an keine Grenze gebunden». Die Todesrate stieg infolgedessen 1941 und 1942 dramatisch an. In den letzten Kriegsjahren schnellten die Häftlingszahlen in die Höhe, so dass sich Ende 1944 über 63.000 Menschen unter katastrophalen hygienischen Bedingungen in den Baracken drängten. Im November 1944 brach eine Flecktyphus-Epidemie aus, an der Tausende starben.
Noch kurz vor Kriegsende, am 26. April 1945, mussten rund 7.000 Häftlinge das Lager zum «Todesmarsch» Richtung Alpen verlassen - über 1.000 Menschen starben an Erschöpfung oder durch die Kugeln der nervösen Wachleute. Am Nachmittag des 29. April schließlich übernahm Brigadegeneral Henning Linden von der Rainbow-Divison das KZ. Die Schreckensherrschaft der Nazis hatte in Dachau ein Ende.
Das ehemalige KZ wurde zunächst als Internierungslager für 25.000 NS-Funktionäre und Angehörige der SS genutzt. Ab 1948 war das ehemalige Lager eine Flüchtlingssiedlung. 1965 wurde die KZ-Gedenkstätte Dachau eröffnet, die Jahr für Jahr von über 800.000 Menschen aus aller Welt besucht wird. Zur KZ-Gedenkstätte gehört auch die evangelische Versöhnungskirche, die ein «geschützter Raum zum Atemholen» sei, wie Gedenkstättenleiterin Distel sagt.
Vor 75 Jahren errichteten die Nazis das KZ-Dachau - Beckstein: Mahnung gegen Rassismus und Fremdenhass
Vorbild für Terror und Vernichtung
Antisemitismus, Rassismus und Fremdenhass dürfen nach den Worten des bayerischen Ministerpräsidenten Günther Beckstein (CSU) nie wieder das politische Handeln in Deutschland bestimmen. Die Erinnerung an die massenhafte Unterdrückung, Misshandlung und Ermordung in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten sei Auftrag und Verpflichtung, mahnte Beckstein zum 75. Jahrestag der Errichtung des ehemaligen Lagers Dachau. Beckstein rief dazu auf, sich der Geschichte zu stellen, damit menschenverachtende Ideologien nie wieder Fuß fassen könnten.
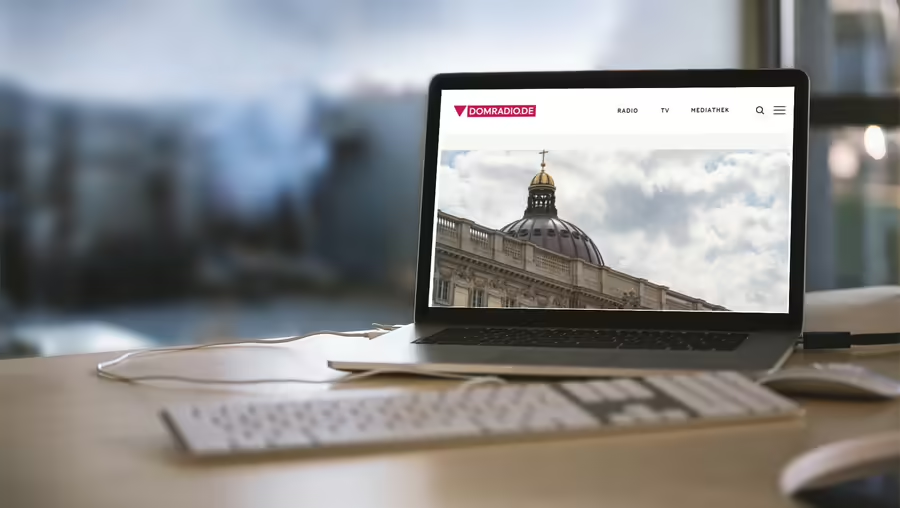
Share on
