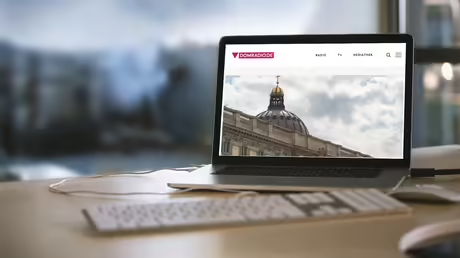"Die Situation ist schrecklich. Es gibt keinen Schutz für die Flüchtenden. Die Menschen sitzen tagaus, tagein in der sengenden Hitze", berichtet Caritas Südafrika.
Die früher florierende Bergbaustadt Musina liegt genau zwischen Johannesburg und Harare in einer wirtschaftlich aktiven Region. Migranten aus Simbabwe gehören hier schon seit Jahren zum Alltagsbild; mehr als eine Million sollen nach Schätzungen in Südafrika leben. Sie arbeiten als Farmer oder Tagelöhner und verdienen gerade genug, um sich und ihre zurückgelassenen Familien zu versorgen. Doch seit sich die Krise in Simbabwe zuspitzt und die Cholera auch über die Grenze nach Südafrika schwappt, spitzt sich die Lage zu. Schon wegen der hohen Arbeitslosigkeit werden Migranten zunehmend als unerwünschte Eindringlinge angesehen.
Mit solch kritischen Situationen in Afrika südlich der Sahara befasst eine am Wochenende beendete Konferenz des Internationalen Konversionszentrums (BICC) in Bonn. "Noch immer ist die Vorstellung weit verbreitet, dass der Großteil der afrikanischen Migranten nach Europa abwandert. Dies ist jedoch nicht der Fall", unterstreicht BICC-Direktor Peter J. Croll.
Über zwei Drittel aller Migranten aus Ländern südlich der Sahara bleiben innerhalb der Region. Das sind derzeit etwa 16,3 Millionen Menschen, die durch Kriege, Menschenrechtsverletzungen oder Katastrophen in Nachbarstaaten fliehen oder innerhalb ihres Landes vertrieben werden: Wirtschafts- und Umweltflüchtlinge, aber auch reguläre Arbeitnehmer und Saisonarbeiter.
Tiefgreifende Folgen für die Stabilität und Sicherheit
Nach Darstellung des im britischen Coventry lehrenden Bevölkerungswissenschaftlers John O. Oucho haben Migration und Flucht tiefgreifende Folgen für die Stabilität und Sicherheit der Staaten. So weise der Sudan mit bis zu sechs Millionen die höchste Zahl an Binnenvertriebenen weltweit auf. Umgekehrt zählten Tansania, Tschad und Uganda zu den zehn größten Aufnahmeländern von Flüchtlingen. Der gebürtige Kenianer beklagte, dass die meisten afrikanischen Staaten sich mit den Auswirkungen dieser Wanderungsbewegungen zu wenig befassten und auch keine gezielten Konzepte zum Umgang mit den Betroffenen entwickelten.
Dabei steht für die Experten fest, dass die Migration auch im südlichen Afrika eher noch zunehmen wird: So bieten Globalisierung und bessere Bildung wachsende Anreize, ihre Lebenschancen anderswo zu suchen, analysiert Wim Naude von der UN-Universität in Helsinki. Nach einer UN-Studie werden zudem bis 2050 mindestens 200 Millionen Menschen aufgrund von Umweltproblemen ihre Heimat verlassen müssen.
Unberechenbare Entwicklungen
Die BICC-Tagung machte deutlich, dass es angesichts der großen Migrationsströme auch Gewinner gibt: Die Geldsummen, die Migranten aus Entwicklungs- und Schwellenländern nach Hause schicken, betragen nach Schätzungen mehr als 100 Milliarden Euro im Jahr - mehr als die weltweite Entwicklungshilfe. Offen bleibt freilich die Frage, wie weit afrikanische Länder von dem Wissen profitieren können, dass sich ihre Staatsbürger im Ausland aneignen. Von "Brain Gain" (Gewinn an Wissen) und "brain circulation" (Umlauf von Wissen) war die Rede, aber auch von "brain waste" (Verschwendung von Wissen), wenn gut ausgebildete Afrikaner in den Industriestaaten einfachste Arbeiten verrichten müssen, um sich über Wasser zu halten.
Wie unberechenbar solche Entwicklungen sind, zeigt das Beispiel
Südafrika: Zwischen 1994 und 2000 investierte das Land rund eine Milliarde Dollar in die Ausbildung von Gesundheitspersonal, das dann später in englischsprachige Länder auswanderte. Um dennoch den Bedarf an Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern zu decken, lockte Südafrika Personal aus Ländern wie Malawi an. Dort, in einem der ärmsten Länder der Welt, sind inzwischen fast zwei Drittel der Jobs im Gesundheitssektor unbesetzt - aus Personalmangel.
Internationale Konferenz zu Migration und Vertreibung in Afrika
Unerwünschte Eindringlinge
Es ist eine explosive Situation: Rund 3.000 vor der humanitären Krise aus ihrem Land geflüchtete Simbabwer sind in der südafrikanischen Grenzstadt Musina auf einem Fußballfeld zusammengepfercht. Mit solch kritischen Situationen in Afrika südlich der Sahara befasst eine am Wochenende beendete Konferenz des Internationalen Konversionszentrums (BICC) in Bonn.
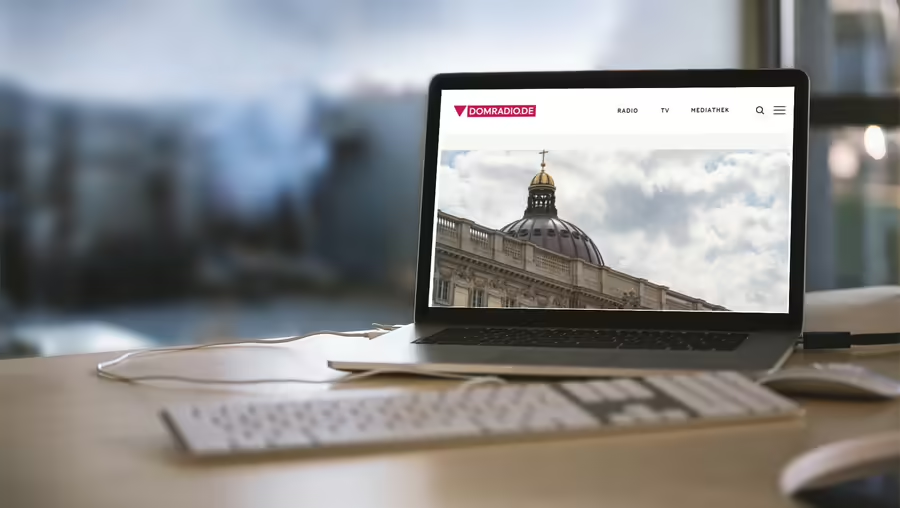
Share on