«Das ist ein Durchbruch.» Der Bonner Medizinprofessor Eberhard Klaschik (66) sieht die Palliativmedizin in Deutschland auf einem guten Weg. Die Palliativmedizin, die neben der Bekämpfung von Schmerzen auch die psychologische und geistliche Betreuung Sterbenskranker umfasst, ist künftig Bestandteil der Approbationsordnung für Ärzte.
Dazu passt, dass sich die Zahl der Lehrstühle für Palliativmedizin in den kommenden Monaten deutlich erhöhen wird. Neben den bereits bestehenden fünf Lehrstühlen in Bonn, Köln, Aachen, München und Göttingen sollen bis Sommer 2010 noch drei weitere geschaffen werden: an den Hochschulen von Erlangen, Mainz und Freiburg. Seit wenigen Monaten bestehen zudem - in München und in Witten-Herdecke - zwei Lehrstühle für Kinderpalliativmedizin. Immerhin leben in Deutschland rund 23.000 Kinder und Jugendliche mit unheilbaren, zum Tode führenden Krankheiten. Jährlich sterben rund 5.000 von ihnen an einer solchen Erkrankung.
Für Klaschik, bis 2006 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin und derzeit bei der Deutschen Krebshilfe für das Thema Palliativmedizin zuständig, ist das eine erfreuliche Entwicklung, die aber nicht ausreicht. «Wir brauchen an jeder deutschen Hochschule, die Ärzte ausbildet, einen Lehrstuhl für Palliativmedizin», sagte der emeritierte Bonner Medizinprofessor der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Das werde sich aber nur nach und nach verwirklichen lassen, weil in diesem in Deutschland lange vernachlässigten Fachgebiet erst eine entsprechende Auswahl von Spitzenkräften herangebildet werden müsse.
Rar sind vor allem Mediziner, die die Forschung vorantreiben können. Hingegen gebe es bereits jetzt an den meisten Hochschulen Lehrbeauftragte, die den medizinischen Nachwuchs in Palliativmedizin ausbilden können. An vielen Unikliniken bestehen zudem inzwischen Palliativstationen für nicht mehr heilbare Patienten - Gelegenheit für die Studierenden, sich mit solchen Situationen auseinanderzusetzen.
Wie nötig das ist, zeigt eine Dissertation, die 2007 an dem von Klaschik 1999 eingerichteten und bundesweit ersten Lehrstuhl für Palliativmedizin in Bonn erstellt wurde. Danach gaben rund 70 Prozent der befragten Medizinstudenten in Bonn und Düsseldorf an, Angst vor dem Umgang mit unheilbar kranken Patienten zu haben. Als Gründe nannten sie vor allem die Hilflosigkeit, den Patienten nicht heilen zu können, sowie ihre mangelnden Kenntnisse bei Schmerztherapie und Kontrolle der Symptome. Klaschik zitiert einen der Studierenden mit den Worten «Ich habe Angst davor, einem Patienten sagen zu müssen: Ich kann nichts mehr für Sie tun.»
Zugleich deutet die Studie laut Klaschik auch darauf hin, dass eine palliativmedizinische Ausbildung die Haltung künftiger Mediziner zu Sterben und Tod deutlich ändern könnte: Nach der Befragung von Studenten im zweiten Semester ergab sich eine hohe Zustimmung zu aktiver Sterbehilfe, die in Bonn Werte von 50 Prozent und in Düsseldorf von rund 37 Prozent erreichte. Im sechsten Semester sank die Zustimmungsrate in Bonn allerdings auf 22,4 Prozent, was Klaschik auch auf die Verankerung des Fachs an der dortigen Universität zurückführt. In Düsseldorf, wo die Palliativmedizin eine geringere Rolle spielt, blieb der Wert nahezu gleich.
Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich bei der Frage, ob die Medizinstudenten aktive Sterbehilfe durchführen würden, wenn es legal wäre und ein Patient sie darum bitten würde. Mit Ja antworteten im zweiten Semester in Düsseldorf 43,4 und in Bonn 25 Prozent. Im sechsten Semester waren diese Werte in Düsseldorf auf 35,7 Prozent und in Bonn auf 20,4 Prozent gesunken.
Palliativmedizin ist künftig Pflicht für Medizinstudenten
Ein Durchbruch für die Versorgung Sterbender
Am Mittwoch ist das vom Bundestag im Juni verabschiedete "Gesetz zur Regelung des Assistenzpflegebedarfs im Krankenhaus" in Kraft getreten. Es sieht - neben vielen anderen Regelungen - vor, dass Medizinstudenten künftig auch für die Versorgung Schwerstkranker und Sterbender ausgebildet und in diesem Fachgebiet auch geprüft werden. Das Gesetz wird als Durchbruch gewertet.
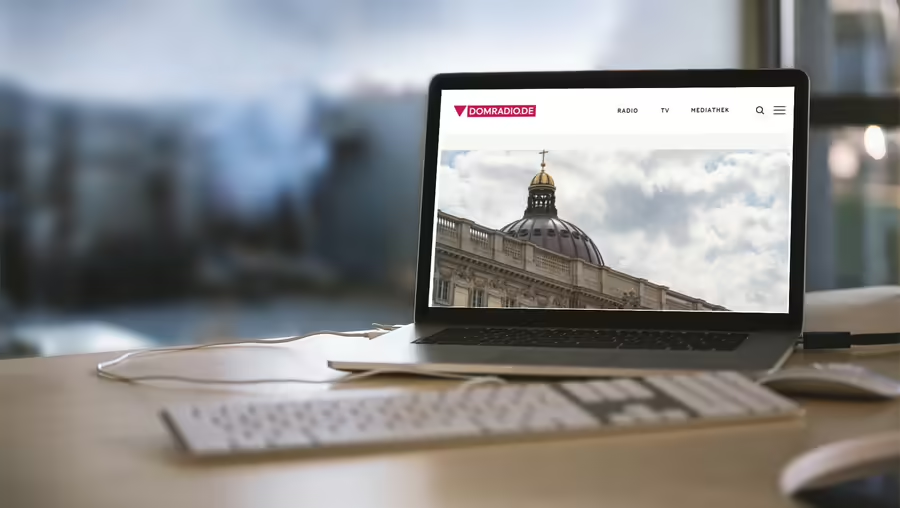
Share on
