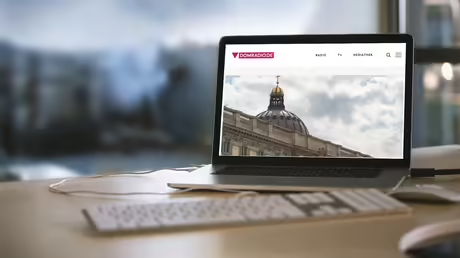KNA: Herr Wolff, die Finanzmärkte der Industrienationen zittern vor dem Börsencrash. Wie gefährlich ist er für die Entwicklungsländer?
Wolff: Die Aufblähung des Finanzsektors in den letzten 20, 30 Jahren und seine Abkopplung von der Realwirtschaft sind Phänomene der OECD-Länder, also des Westens. In Entwicklungsländern hat es das nicht gegeben. Für die Banken dort spielt das klassische, quasi lokale Kundengeschäft weiter die Hauptrolle, während es bei Instituten wie der Deutschen Bank nur noch 20 Prozent des Geschäfts ausmacht - der Rest steckt im globalen Casino. Das Finanzwesen in Entwicklungsländern ist also viel weniger eng mit den internationalen Märkten und Börsen verflochten. Nur einige Schwellenländer haben Reserven, die sie dort anlegen könnten. Schon bei der ersten Krisenwelle 2008/09 hat man gesehen, dass die Kapitalvernichtung vor allem die reichen Länder trifft. Allerdings trifft es die armen Länder indirekt.
KNA: Inwiefern?
Wolff: Wie wir erlebt haben, schlagen Finanzkrisen schnell auf die produzierende Realwirtschaft durch. Und Rezessionen in den Industrieländern wirken sich dann sehr wohl auf die schwachen Volkswirtschaften des Südens aus, denn die sind stark abhängig von den Rohstoffpreisen. Nehmen Sie ein Land wie Sambia, das vor allem vom Kupferexport lebt. Während der Krise brach der Kupferpreis wegen sinkender Nachfrage plötzlich um über 60 Prozent ein. Weil die Rücklagen fehlen und das soziale Netz in armen Ländern ohnehin hoffnungslos unterfinanziert ist, werden Haushalte und heimische Wirtschaft von solchen Einnahmeausfällen stark belastet - obwohl die Verluste nur einen Bruchteil der Summen ausmachen, die in den Überflussgesellschaften verbrannt werden.
KNA: Also sind die armen Länder doch die eigentlichen Verlierer der Krise?
Wolff: Ja und Nein. Ihnen bieten sich auch Chancen. So ist es für kapitalschwache Staaten angesichts der krisenbedingt hohen Liquidität viel leichter, an günstige Kredite zu kommen. Ghana zum Beispiel hat zuletzt eine große Summe am Kapitalmarkt aufnehmen können und dabei weniger Zinsen gezahlt als Griechenland oder Portugal. Außerdem bleiben die Entwicklungsländer wegen ihrer hohen Gewinnspannen attraktiv für Investitionen aus dem Ausland, besonders in der Landwirtschaft.
KNA: Aber woher kommt das Kapital, wenn die Investoren selbst unter der Krise zu leiden haben?
Wolff: Viel hängt davon ab, ob Schwellenländer wie etwa China, das in Afrika sehr engagiert ist, oder Indien oder Brasilien den Ausfall westlicher Investoren in den Entwicklungsländern kompensieren können und wollen. Die Schwellenländer haben den Vorteil, dass sie nicht so stark auf den internationalen Finanzmärkten gebunden sind wie die OECD-Länder, aber weniger verschuldet sind und über flüssiges Kapital verfügen. Die Frage ist einerseits, ob die Investitionen auf Nachhaltigkeit angelegt sind und andererseits ob die Rahmenbedingungen für Investitionen stimmen. Da hapert es besonders in Schwarzafrika, wo oft schlechte Infrastruktur, korrupte Verwaltungen, mangelnde Bildung oder innere Konflikte die Investoren abschrecken.
KNA: Der Kampf gegen solche Probleme gründet nach wie vor stark auf der Entwicklungshilfe. Sind hier größere Einbrüche zu erwarten, falls die Finanz- und Schuldenkrise sich weiter ausdehnt?
Wolff: Das ist noch schwer abzuschätzen. Der Sparzwang in den USA und Europa wird sicherlich auch Auswirkungen auf deren Engagement in der Entwicklungspolitik haben. Im deutschen Fall hat sich gezeigt, dass die Zuwächse bei der Entwicklungshilfe weit unter den früheren Zusagen geblieben sind. Das Ziel von 0,7 Prozent des Bruttosozialprodukts bis 2015 wird mit Sicherheit nicht erreicht. Auch hier ist denkbar, dass die krisenbedingte Belastung der Staatsfinanzen eine Rechtfertigung bietet.
KNA: Ist die Arbeit von Hilfswerken ebenfalls vom Geschehen an den Börsen betroffen?
Wolff: Zumindest während der ersten Krisenwelle 2008/09 ist es offenbar nicht zu wesentlichen Spendeneinbrüchen gekommen. Mir ist auch nicht bekannt, dass die großen Hilfswerke größere Summen auf den Finanzmärkten verloren haben. Wenn sie überhaupt freies Geld anlegen, tun sie das in konservativen, wenig riskanten Produkten.
Aber auch hierbei wächst ja die Unsicherheit. Noch vor wenigen Jahren galten zum Beispiel auch griechische Staatsanleihen als konservative Anlage.
Das Interview führte Christoph Schmidt (KNA)
Forscher Peter Wolff über die Finanzkrise und Entwicklungsländer
"Die Armen trifft es indirekt"
Die geringe Verflechtung ihres Bankwesens mit den krisengeschüttelten internationalen Finanzmärkten könnte sich für Entwicklungsländer als Vorteil erweisen. Das meint Peter Wolff, der am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik in Bonn über Auswirkungen der Aktienkrise auf arme Staaten erforscht. Er verweist aber auch auf ökonomische Gefahren, die sich daraus für Entwicklungsländer ergeben.
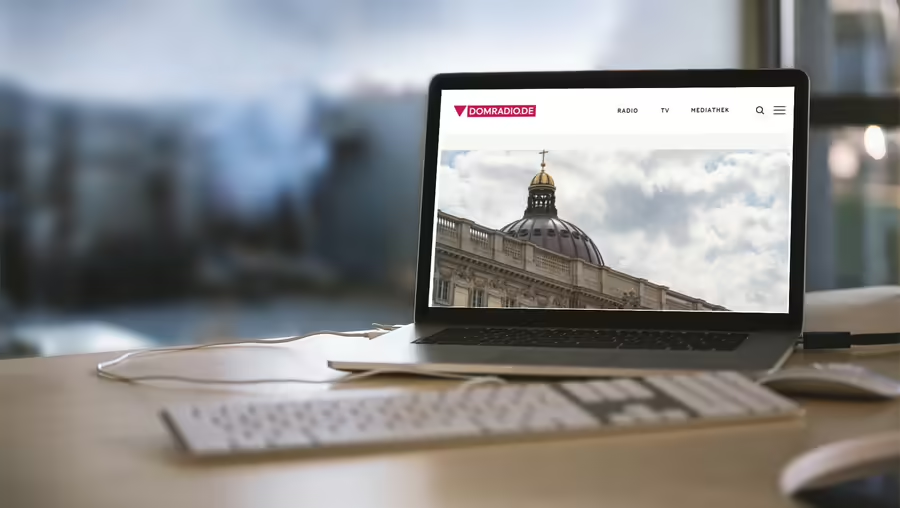
Share on