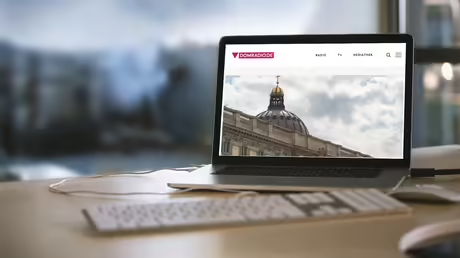KNA: Herr Professor Hoppe, Sie haben immer wieder eine Neuregelung der Gesetzgebung zur Spätabtreibung verlangt. Wie bewerten Sie, dass die gemeinsame Gesetzesinitiative der Großen Koalition gescheitert ist?
Hoppe: Wir haben vor allem eine Ergänzung in den Paragrafen 218 und 219 Strafgesetzbuch vorgeschlagen. Dort ist nämlich bei der Reform des Schwangerschaftsabbruchrechts 1995 mit der Abschaffung der embryopathischen Indikation die derzeit so beklagenswerte Situation entstanden. Die bestehende Regelung zum Schwangerschaftsabbruch nach medizinischer Indikation ist nicht fristgebunden. Wir hätten uns gewünscht, dass die 22. Schwangerschaftswoche beziehungsweise der Zeitpunkt, an dem das Kind alleine überlebensfähig ist, die zeitliche Grenze für eine Abtreibung darstellt. Darüber hinaus sollte ein solcher Spätabbruch nur in absoluten Ausnahmefällen möglich sein. Unser Vorschlag war aber innerhalb der Koalition nicht mehrheitsfähig. Nun will die Union zumindest das Schwangerschaftskonfliktgesetz ändern. Sie fordert eine dreitägige Frist zwischen der Diagnose und einer möglichen Abtreibung, sowie eine besondere Beratungspflicht von Ärzten und das Angebot einer weiteren psychosozialen Beratung.
KNA: Die SPD verweist auf die Beratungspflichten in dem geplanten Gendiagnostikgesetz. Ist der Unions-Entwurf damit überflüssig?
Hoppe: Nein, ganz und gar nicht. Das Gendiagnostikgesetz bezieht sich auf eine andere Thematik und erfasst nur eine Teilmenge des Problems. Das Spektrum möglicher medizinischer Indikationen ist weitaus größer. Somit ist dieser Vorschlag völlig unzureichend und lässt die eigentlichen Erfordernisse außer Acht.
KNA: Inwiefern?
Hoppe: Das Gesetz betrifft nur genetische Störungen. Es gibt aber auch andere schwerwiegende Belastungen, die eine medizinische Indikation begründen können. Denken Sie nur an psychische Störungen der Schwangeren oder das Phänomen der Schwangerschaftsverdrängung. Das alles bleibt in dem Entwurf des Gendiagnostikgesetzes außen vor.
Wir hoffen deshalb, dass der Gesetzentwurf der Union, der ein breites Beratungsangebot vorsieht und eben auch eine dreitägige Bedenkzeit einschließt, möglichst viele Unterstützer aus den anderen Fraktionen findet, um eine Mehrheit für einen Gruppenantrag zu erhalten.
KNA: Bei der Diskussion um die Sterbehilfe beklagen Sie eine Begriffsverwirrung. Wo sehen Sie diese Gefahr?
Hoppe: Unter Sterbehilfe scheinen manche inzwischen nicht nur Tötung auf Verlangen, sondern auch das Sterbenlassen eines Patienten zu verstehen. Das ist ein großer Irrtum. Wenn eine große Boulevardzeitung am Wochenende titelte, dass jeder fünfte Krankenhausarzt Sterbehilfe geleistet hat, entsteht der irrige Eindruck, hier habe der Arzt Patienten etwa durch punktgenaue Injektion getötet. Im Text wird dann aber deutlich, dass es eigentlich um Sterbebegleitung geht, also nicht um ein aktives Töten im Sinne der Euthanasie.
KNA: Können Sie den Unterschied im praktischen Umgang mit Sterbenden genauer erläutern?
Hoppe: Die palliativmedizinische Sterbebegleitung hat den Sinn, Schmerzen zu lindern und Angst zu nehmen. Sie tritt ein, wenn der Krankheitsprozess unumkehrbar ist. Deshalb sprechen wir von einer «Therapiezieländerung». Dann kann im Einverständnis mit dem Patienten eine Behandlung unterlassen werden, die den Sinn hat, die Krankheit zu bekämpfen. Das ist aber keine Tötung! Wie wir aus Erfahrung wissen, kann dieser letzte Lebensabschnitt, dieses Loslassen, für den Patienten sehr erfüllend sein.
KNA: Kann das auch bedeuten, dass der Arzt die Ernährung einstellt?
Hoppe: Das muss der Arzt im Einzelfall entscheiden. Hat der Patient ein Hunger- oder Durstgefühl, ist es selbstverständlich, dass wir Hunger und Durst stillen. Die früher auch von uns vertretene Regel, dass man ernähren muss, weil dies sonst zum Tod führt, haben wir aber längst verlassen. Denn bestimmten Patienten fügt man mit Nahrungszufuhr mehr Leid zu, als dass man ihnen Gutes tut. Wenn ein Patient die Nahrungsaufnahme verweigert, dann respektieren wir das und zwingen ihn nicht dazu.
KNA: Kritiker beklagen, dass oft zu früh eine Magensonde gelegt wird und damit diese Möglichkeit nicht mehr gegeben ist.
Hoppe: Das ist ein großes Problem. Oft fehlen Pflegekräfte. Da eine Sonde die Ernährung auch praktisch erleichtert, machen manche Heime die Sonde sogar grundsätzlich zur Vorbedingung einer Aufnahme. Wir beklagen und bekämpfen das. Es gibt aber auch Fälle, wo die Magensonde medizinisch indiziert ist, weil sonst keine Ernährung stattfinden kann. Dann sollte sie auch in Absprache mit dem Patienten gelegt werden.
KNA: Im Gegensatz zur aktiven Sterbehilfe oder der Tötung auf Verlangen ist die Beihilfe zum Suizid in Deutschland nicht verboten, wie der Fall von Roger Kusch zuletzt deutlich machte. Wie bewerten Sie das aus Sicht der Ärzteschaft?
Hoppe: Die Beihilfe zum Suizid ist straffrei, weil der Suizid straffrei ist. Das gilt in der Tat auch für Ärzte. Aber es ist mit dem Ethos des Arztes unvereinbar. Denn Ärzte treten im Bewusstsein der Bevölkerung für das Leben und nicht für die Tötung ein. Würde das indirekte Töten zum Handwerkszeug der Ärzte, dann würde dies das Vertrauensverhältnis zu Patienten zutiefst erschüttern.
KNA: In den Niederlanden gehört dies allerdings mit zur Aufgabe der Ärzte.
Hoppe: In der Tat ist dort eine so große Verunsicherung eingetreten, dass Menschen in ihrer Patientenverfügung sogar ausdrücklich festhalten: «Ich will im Falle meiner Geschäftsunfähigkeit nicht getötet werden». Für uns widerspricht die Beihilfe zum Suizid dem Selbstverständnis des Arztes. In den allermeisten Fällen ist der Wunsch zum Sterben auf eine Krankheit zurückzuführen. In der Regel ist das eine Depression; sei sie körperlich bedingt oder auf äußere Gründe zurückzuführen, wie etwa ein Trauma. Deshalb ist in diesem Falle Zuwendung gefordert, nicht Beihilfe zur Tötung.
KNA: In den Niederlanden findet die Sterbehilfe angeblich auch vermehrt über die Dosierung von Schmerzmitteln statt.
Hoppe: Früher sprach man von indirekter Sterbehilfe, wenn Medikamente gegen Schmerzen und Angst als Nebenwirkung die Lebenserwartung verkürzen. Selbst Papst Pius XII. hat dies moraltheologisch gerechtfertigt, sofern das eigentliche Ziel die Schmerzlinderung ist. Wie wir heute wissen, führt die Medikation aber nicht selten zur Lebensverlängerung, weil sich die Entspannung auf den Gesamtzustand des Patienten positiv auswirkt. Grundsätzlich lässt sich die Frage aber kaum beantworten, weil niemand weiß, wie lange der Patient ohne diese Medikamente gelebt hätte.
KNA: Trotz der jüngsten Lockerung des Stammzellgesetzes haben Wissenschaftler auf einem Fachkongress in Dresden am Montag die rechtlichen Rahmenbedingungen als zu eng kritisiert. Können Sie das nachvollziehen?
Hoppe: Ich bin gegen eine weitere Liberalisierung. Die Verschiebung des Stichtags ist uns schwer genug gefallen. Deutsche Wissenschaftler haben nun dieselben Bindungen wie im Ausland, abgesehen von wenigen Ausnahmen. Sie sind damit in der internationalen Forschung absolut konkurrenzfähig. Jetzt sollen die Forscher erst einmal Ergebnisse vorzeigen. Wenn sie Therapien entwickeln, die keine dauerhafte Verwendung embryonaler Stammzellen verlangen, könnte deren Einsatz ethisch vertretbar sein. Aber solche Therapien sind bislang noch nicht in Sicht.
Ärztepräsident Hoppe beharrt auf Neuregelung bei Spätabtreibung
"Völlig unzureichend"
Der Präsident der Bundesärztekammer, Jörg-Dietrich Hoppe, hat seine Forderung nach einer Neuregelung der Spätabtreibung bekräftigt. Die von der SPD favorisierte Beratungspflicht für Ärzte im Rahmen des geplanten Gendiagnostikgesetzes greife zu kurz, sagte Hoppe am Mittwoch in einem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) in Berlin. Er äußerte sich auch zu Fragen der Sterbehilfe und zur Forderung nach einer weiteren Liberalisierung des Stammzellgesetzes.
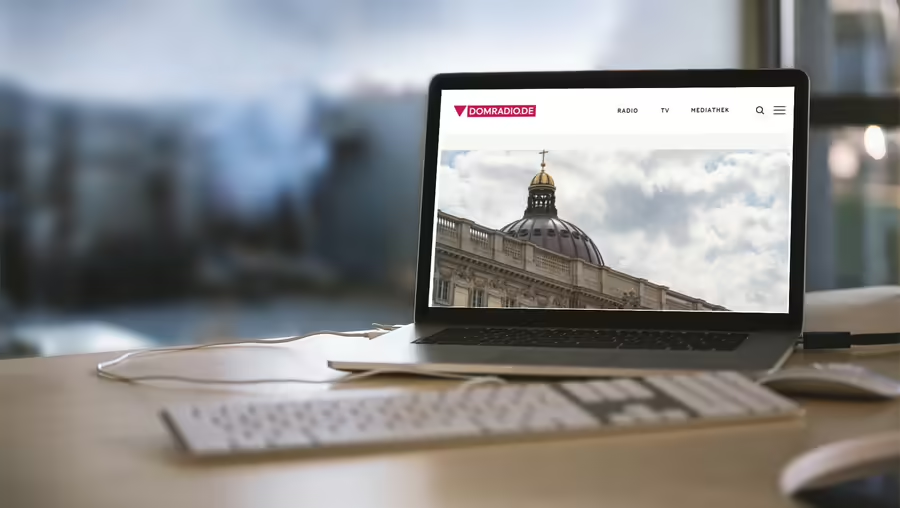
Share on