Schließlich erhöhen sich die Beiträge zur Pflegeversicherung um 0,25 Prozent. Die Verbesserungen bei der Qualitätssicherung und verkürzte Bearbeitungszeiten sollten auch vor Ort zu spüren sein. So werden Heime nicht mehr nur alle drei Jahre und nach vorheriger Anmeldung, sondern jährlich und in der Regel unangemeldet geprüft. Zudem sind zusätzlich 200 Millionen Euro für die stationäre Betreuung von Demenzkranken vorgesehen.
Doch schon das Thema Pflegestützpunkte zeigt, wie kompliziert die schwarz-rote Gemengelage ist. Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) wollte sie stets, die Unions-Fachpolitiker bekämpften sie vehement. Zeitweise wirkte die Kontroverse wie ein Stellvertreterkrieg, weil sich die Koalitionäre partout beharken wollten. Kein Zufall, dass erst die Klausur der Fraktionsspitzen Ende Februar bei Bonn den Durchbruch brachte. Kaum ein anderer Themenbereich hat solche Relevanz für jeden Einzelnen wie der Gesundheitssektor, entsprechend kräftig ist das Lobbying in Berlin. Das gilt auch für das Element Pflege.
Nun sollen - Kompromiss um des Koalitionsfriedens willen - die Bundesländer entscheiden. Selbst Fachverbände geben da unterschiedliche Signale: Der Diözesancaritasverband Freiburg hofft auf eine zügige Umsetzung, der bayerische Caritas-Landesverband warnt vor Bürokratie. «Die Idee der Pflegestützpunkte, Information und Beratung zu vernetzen, ist gut und richtig», meint Caritas-Präsident Prälat Peter Neher. Aber auch er sieht drohende Defizite wegen fehlender Selbstständigkeit. Statt der von Schmidt avisierten 4.000 Stützpunkte wird es bundesweit wohl nur 1.200 bis 1.500 geben. Ganz raus fielen die von Schmidt angestrebten zehn bezahlten Pflegetage.
Dramatisch ist, dass die Frage der langfristigen Finanzierung der Pflege vertagt ist. «Die Pflegeversicherung bleibt ein zentraler Baustein der sozialen Sicherungssysteme», hieß es im Koalitionsvertrag von 2005. Dem folgte die Mahnung, dass die erwerbstätige Generation nicht überfordert werden dürfe und Eigenverantwortung zu stärken sei. Doch die Konzepte - die SPD favorisiert eine Bürgerversicherung und die CDU das Modell einer Kapitaldeckung - sind zu unterschiedlich. Das lastet bleiern über den jetzt zu beschließenden Regelungen.
Caritas-Chef Neher bewertet es als «größten Schwachpunkt am Gesetzentwurf», dass es keine langfristige finanzielle Absicherung der Pflege geben wird. In wenigen Jahren werde diese Frage wieder auf der Tagesordnung stehen, sagte er im Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Sein Verband drängt auf einen Risikoausgleich zwischen der Sozialen und der Privaten Pflegeversicherung sowie einen kollektiven Kapitalstock zur Abfederung der demografischen Entwicklung. Doch wie das konkret aussehen kann, wird sich erst in der nächsten Legislaturperiode zeigen. Eine große Koalition ist zu einer solchen Richtungsentscheidung nicht in der Lage - trotz jahrelanger Verhandlungen.
Bundestag beschließt heute das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz
Nach der Reform ist vor der Reform
Wird am Ende immer gut, was lange währt? Die nach jahrelangen Verhandlungen erreichte Verständigung beim Pflege-Weiterentwicklungsgesetz, das der Bundestag am Freitag beschließen wird, verkauft die Koalition als Erfolg. Der Deutsche Caritasverband hat das Konzept jedoch als unzureichend bewertet. In jedem Fall werden die neuen Regelungen, die zum 1. Juli in Kraft treten, Veränderungen bringen, die nicht nur Betroffene und ihre Angehörigen merken.
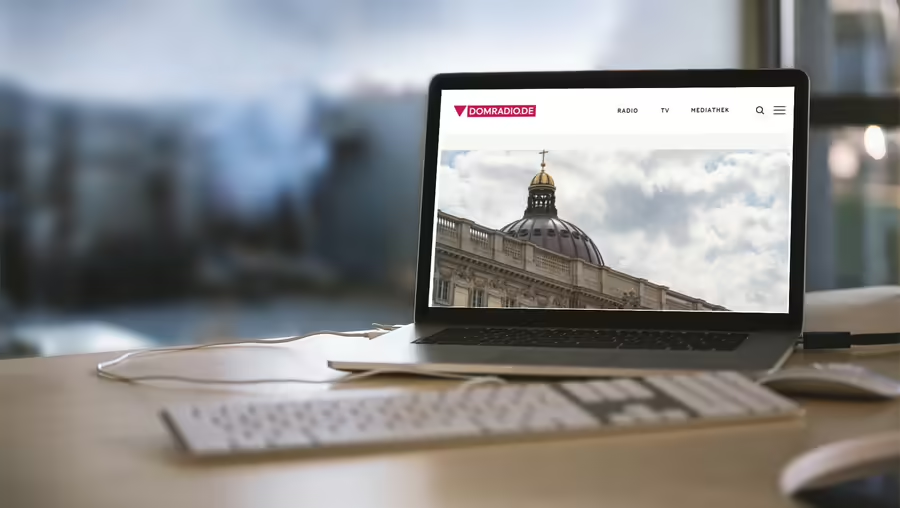
Share on
