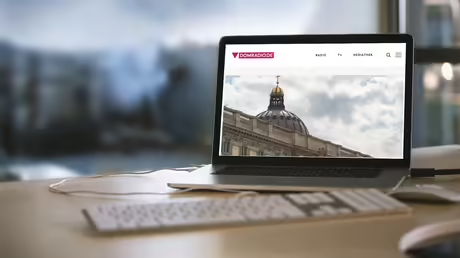domradio.de: Warum, glauben Sie, ist es als harmlos zu werten, dass der Papst die so genannte Einsetzungsformel umformuliert hat? --
Andreas Püttmann: Also, harmlos hört sich ja fast so an wie "Der will ja nur spielen", als würde es sich hier beim Papst um eine potentielle Gefahrenquelle handeln. Aber im Ernst: Es ist ja ein wortwörtliches Bibelzitat, zu dem wir zurückkehren. Und wer das nun als gefährlich bezeichnet, der muss auch Jesu Worte selbst als gefährlich bezeichnen. Und der zweite Punkt: Es gibt einfach von Papst Benedikt eine sehr differenzierte Begründung, die zeigt, dass er eigentlich alle Aspekte berücksichtigt hat und auch zu würdigen weiß. Und allein diese differenzierende Begründung sollte doch die Gemüter etwas beruhigen.
domradio.de: Würden Sie sagen, dass der Papst sich den Ultrakonservativen annähert?--
Püttmann: Das würde ich nicht sagen. Denn dann wären ja auch die Sprachfamilien, die schon immer "für viele" gesagt haben, die französische etwa, oder jetzt wieder "für viele" sagen, wie die englische und spanische, auch pauschal zu den Ultrakonservativen zu zählen. Es ist ja nicht so, dass nur die Piusbrüder auf das "für viele" pochen. Und zum anderen sollte man auch beachten: Gestern schrieb mir zum Beispiel ein evangelischer Freund: Ist ja prima, dass die katholische Kirche jetzt zur "sola scriptura" zurückkehrt, also zur schriftgemäßen Ausdrucksweise. Es kommt also auch von evangelischer Seite durchaus Unterstützung und sogar von atheistischer Seite: Man kann im Internet in einigen einschlägigen Blogs lesen, dass Atheisten sich verbeten haben, dass Jesus Christus auch für sie alle gestorben sei. Das wird als Heilsimperialismus abgelehnt. Insofern sind die Koalitionen viel differenzierter als dieses grobe Denken der Gegenüberstellung von ultrakonservativen und wahren Katholiken.
domradio.de: Sie kritisieren vor allen Dingen den Kommentar des Journalisten Joachim Frank im Kölner Stadt-Anzeiger hart, warum?--
Püttmann: Ich finde zunächst einmal, dass er den Papst ungerecht beurteilt, in dem, was er sagt. Da wird zum Beispiel behauptet, der Papst verkünde einen exklusiven Jesus. Und wenn man sich einmal anschaut, was der Papst wirklich gesagt hat, ist das einfach nicht haltbar. Ich darf vielleicht einmal kurz zitieren aus Benedikts Brief: "Das Wirken Jesu umfasst die ganze Menschheit, Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft. Aber faktisch, geschichtlich, in der konkreten Gemeinschaft derer, die Eucharistie feiern, kommt er nur zu "vielen". Wie der Herr die anderen alle auf seine Weise erreicht, bleibt letztlich sein Geheimnis. Wir sind viele und stehen für alle, so gehören die beiden Worte viele und alle zusammen und beziehen sich in Verantwortung und Verheißung aufeinander." Das heißt, es wird niemand ausgeschlossen. Aber es wird darauf hingewiesen, dass die eucharistische Gemeinde quasi wie ein "Sauerteig", so der Papst, stellvertretend für alle steht und auch den Auftrag hat, die Botschaft Jesu und das Heil an andere weiterzuvermitteln.
Das ist doch viel differenzierter, als diese ungerechte Kritik. Es beginnt ja schon damit, dass Herr Frank praktisch in Frage stellt, ob es überhaupt ein richtiges und ein falsches Gebet geben könne. Da hat er offensichtlich die Bibel nicht gründlich genug gelesen, denn Jesus selbst unterscheidet zwischen einem richtigen und falschen Gebet, indem er sagt: Wenn Ihr betet, sollt Ihr nicht plappern wie die Heiden. Es ist also nicht so, dass das Gebet etwas völlig Unnormierbares wäre. Das Zweite ist, dass er auch habituell dem Papst nicht gerecht wird, wenn er zum Beispiel sagt, diese Entscheidung wedele nach rechts. Ich glaube, Josef Ratzinger ist wirklich kein Taktiker und kein Opportunist, der seine Entscheidungen davon abhängig macht, wer ihm jetzt irgendwo zustimmt. Und solche Formulierungen wie, es handele sich um ein katholisches Basta oder es ginge darum, den Gläubigen Zweifel auszutreiben oder ihnen etwas beizubiegen, - das sind Ausdrücke, die einen Autoritarismus suggerieren, der der differenzierten Argumentation, dem werbenden Stil des Papstes gar nicht gerecht wird. Und vielleicht noch als letzten Punkt: Ich werfe Herrn Frank auch vor, dass er die Leser mit seiner Argumentationsweise tendenziell manipuliert, etwa zitiert er Erzbischof Zollitsch, den Vorsitzenden der Bischofskonferenz, mit den Worten, hier handele es sich nur um einen wichtigen Impuls oder wertvollen Beitrag. Er verschweigt aber, dass Zollitsch in seiner Stellungnahme auch von einer Klärung und dem Abschluss einer Diskussion spricht. Und das muss er den Lesern natürlich auch mitteilen, sonst hat er die Stellungnahme von Zollitsch doch verzerrt wiedergegeben. Also, ich finde, dass ist wirklich keine gute Art, mit dem Brief des Papstes umzugehen.
domradio.de: Darf man den Papst nicht kritisieren oder was genau stört Sie?--
Püttmann: Man darf den - oder einen - Papst durchaus kritisieren, allerdings würde ich hier drei Voraussetzungen nennen: 1. Nach sehr sorgfältiger Reflexion, also Leichtfüßigkeit und Leichtfertigkeit ist hier nicht angebracht, denn der Papst ist nicht irgendwer, schon gar nicht Benedikt XVI, der nun wirklich ein hoch differenzierter Intellektueller ist. Kritik also nur nach sorgfältiger Befragung des Gewissens. 2. In der geeigneten Diktion, denn der Respekt vor dem Amt verlangt doch, dass man sich in einer angemessenen Sprache zu Wort meldet. Und da hat mir auch nicht gefallen, dass Herr Frank den Papst im letzten Herbst mit Autismus in Verbindung gebracht hat. Das geht einfach gar nicht! Und 3. sollte man auch beachten, wie ist denn die Gemengelage der Diskussion in der Gesellschaft? Und da gilt für mich immer das Motto: Auf wen alle dreinschlagen, der hat vor mir Ruhe! Wenn also jemand eh schon in der Defensive der gesellschaftlichen Diskussion steht, muss ich nicht auch noch auf ihn einschlagen, sondern muss mich im Zweifel vielleicht sogar zum Pflichtverteidiger der Minderheitenposition machen. Wir Christen leben nicht im luftleeren Raum und auch nicht in einer volkskirchlichen Gesellschaft, in der alle sowieso für Christentum und Kirche sind. Und wenn man da gewissermaßen die eigene Spitze angreift, dann muss man sich sehr gut überlegen, ob das in der gegebenen Situation hilfreich ist oder nicht.
domradio.de: Welche Form der Diskussion über strittige Fragen der katholischen Kirche würden Sie sich wünschen?--
Püttmann: Erstens eine sachkundige Diskussion: Man sollte zum Beispiel einmal die Texte des 2. Vatikanischen Konzils wirklich lesen, anstatt nur über den Geist des Konzils zu schwafeln. Zweitens eine differenzierte Argumentation gegen Vereinfachungen. Drittens eine demütige Diskussion mit der nötigen Selbstdistanz, so dass man auch beim Gegner einmal ein bisschen Wahrheit vermuten kann, dass der Heilige Geist nicht nur in einer Ecke der Kirche weht. Und viertens eine freie Diskussion, die durchlässig ist, in der sich die verschiedenen Lager nicht hermetisch gegeneinander abschotten, sondern wo es auch wirklich Foren gibt, in denen Meinungen ausgetauscht werden können. Und das Ganze bitte im Respekt vor dem Lehramt und der Tradition, denn die Tradition ist ja nicht nur irgendeine Theorie, sondern der Glaube, in dem Generationen von Christen vor uns gelebt haben. Und es wäre ein falscher Hochmut, wenn wir meinten, wir könnten sozusagen einmal eben schnell das Rad neu erfinden.
Das Interview führte Christian Schlegel.
Hintergrund
Der Papst hatte im April in einem Brief an die deutschen Bischöfe zur korrekten Übertragung des Wortes "pro multis" Position bezogen. Künftig wird der Priester beim Eucharistischen Hochgebet sprechen: "Das ist der Kelch meines Blutes, des neuen und ewigen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird" - bisher hieß es "für alle". Der Brief des Papstes steht am Ende einer lange währenden Diskussion über die richtige Übersetzung des Kelchwortes. In der deutschen Medienlandschaft wurde dieser "Schlussstrich" teils stark kritisiert. So hatte z.B. Joachim Frank, der Chefkorrespondent des "Kölner Stadtanzeigers", über den Papstbrief einen Kommentar geschrieben, in dem er einen "kirchenpolitischen Zeitgeist, der von Zentralisierung, autoritärer Straffung und Fixiertheit auf Rom geprägt ist", beklagt. Da die Reintegration der Piusbruderschaft in die katholische Kirche, ein erklärtes Ziel Papst Benedikts, kurz bevorzustehen scheint, wirke "Benedikts Brief an die deutschen Bischöfe so, als wedele er freundlich nach rechts", so Frank.
Debatte um das pro multis dauert an
"Für viele" statt "für alle"
Papst Benedikt XVI. hat entschieden: Die Kelchworte sollen im Deutschen "für viele" gesprochen werden und nicht mehr "für alle". Auch im Feuilleton wird nun gestritten, ob diese Entscheidung "harmlos" sei oder für einen "Rechtsruck" des Vatikans stehe. Im domradio.de-Interview erläutert der katholische Publizist Andreas Püttmann, warum in seinen Augen dem Papst in dieser Debatte Unrecht geschieht.
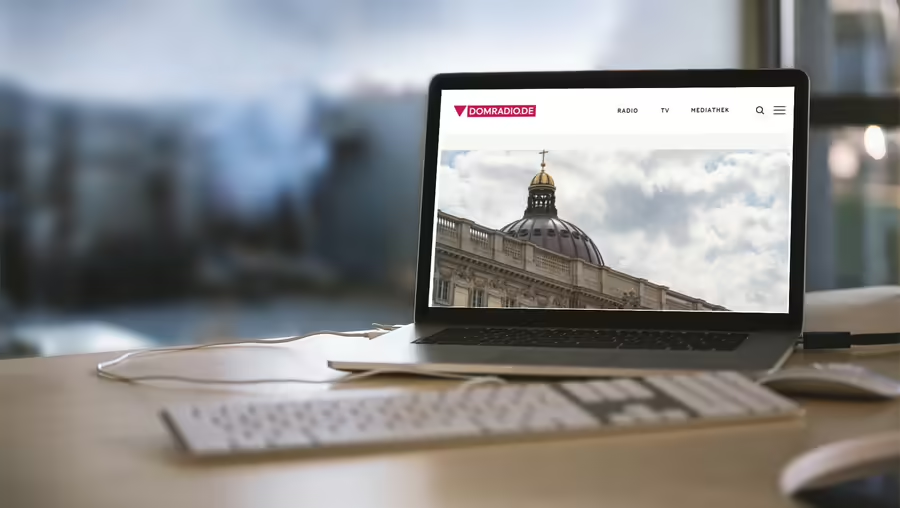
Share on