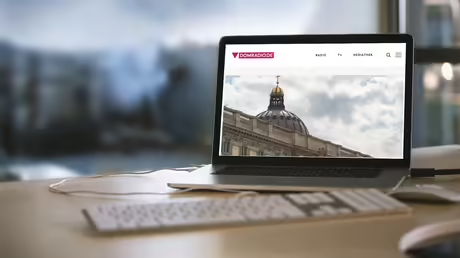«Im Gegenteil, je mehr westliche Firmen auf die Forderungen der Kommunistischen Partei eingehen, umso mehr wird das totalitäre Regime gestärkt», ist der 71-jährige Wu überzeugt. Als Beispiel nennt er die Firma Wal-Mart, die in ihren chinesischen Niederlassungen zwar die Einheitsgewerkschaft zuließ. Die jedoch steht in der Kritik, keinerlei Schutz vor Ausbeutung zu bieten.
Ein zweifelhafter wirtschaftlicher Faktor sei zudem immer noch das System der Zwangsarbeitslager, der Laogai. Harry Wu weiß, wovon er spricht. 19 Jahre lang musste der smarte Intellektuelle dort Sklavenarbeit verrichten, Prügel und Folter aushalten. «Laogai heißt Umerziehung durch Arbeit.» Eines Tages im Jahr 1954 habe ihn die Polizei geholt. Beim Verhör wurde ihm eröffnet, dass er zu lebenslanger Haft verurteilt sei. Einem Richter wurde Wu nie vorgeführt, einen Anwalt sah er nie.
Der damalige Geologiestudent wurde als «konterrevolutionärer Rechtsabweichler» beschuldigt. Schon seine Herkunft machte ihn verdächtig, war doch sein Vater ein wohlhabender Banker aus Shanghai. Hinzu kam Harry Wus Bekenntnis zum katholischen Glauben. In einer Jesuitenschule hatte der Sohn areligiöser Eltern das Christentum kennengelernt und sich mit elf Jahren taufen lassen. Nach dem Einmarsch der Roten Armee 1956 in Ungarn fragten ihn Vertreter der Kommunistischen Partei an der Universität, wie er über die Niederschlagung des Volksaufstands denke. «Ich war dagegen und habe dies zugegeben», so Wu.
Im Arbeitslager war Wu kein Widerständler. «Ich wollte nichts weiter als überleben», sagt er leise. Die Kommunisten richteten seinen Bruder und den Vater hin, die Mutter beging Selbstmord. 1979 kam er frei, sechs Jahre später wurde ihm die Ausreise in die USA genehmigt. «Ich landete in San Francisco mit nur 50 Dollar in der Tasche.» Der Chinese nahm einen Job als Donut-Verkäufer an. Die stark gezuckerten Schmalzkringel sollten für die erste Zeit seine einzige Nahrung sein.
«Heute rühre ich keinen Donut mehr an.»
Das Laogai-System hatte den starken Willen Wus nicht töten können. Mit neuer Kraft ging er seinen Weg. Stipendien führten ihn an die Elite-Unis Berkeley und Stanford. 1992 gründete er die Laogai Research Foundation zur Aufdeckung von Menschenrechtsverletzungen in China sowie zehn Jahre später das China Information Center. Wu enthüllte durch seine Recherchen 1998, dass Delinquenten bei Hinrichtungen in China illegal Organe entnommen und diese lukrativ in den Westen verkauft werden.
«Wir haben auch den Fall Yahoo aufgedeckt», fährt er voller Stolz fort. Zwei chinesische Journalisten waren inhaftiert worden, nachdem das Online-Unternehmen chinesischen Behörden auf Verlangen E-Mails der Regimekritiker zugespielt hatte. US-Kongressabgeordnete übten Druck auf die Firma aus, die schließlich den Familien der politischen Gefangenen Unterstützung zusagte. Die Missstände, die Wu regelmäßig offen legt, haben ihn zum Pessimisten werden lassen. «Ich glaube zwar, dass der Kommunismus verschwinden wird, aber das heißt nicht, dass sich in China eine freie Demokratie entwickelt.»
Der chinesische Katholik und Bürgerrechtler Harry Wu über die düstere Zukunft Chinas
"Olympische Spiele ändern nichts"
Seit dem Tibet-Konflikt ist die Debatte über die Menschenrechte in China wieder neu entfacht. Mag manch einer zuvor noch die Hoffnung gehabt haben, die Olympischen Spiele in Peking würden vieles ändern. Der chinesische Menschenrechtler Harry Wu hätte widersprochen. Seine traurige Botschaft: "Die Weltgemeinschaft übersieht, dass es sich um eine rücksichtslose Diktatur handelt." Die wirtschaftliche Entwicklung in China ziehe nicht, wie im Westen vielfach angenommen, die demokratische Entwicklung nach sich.
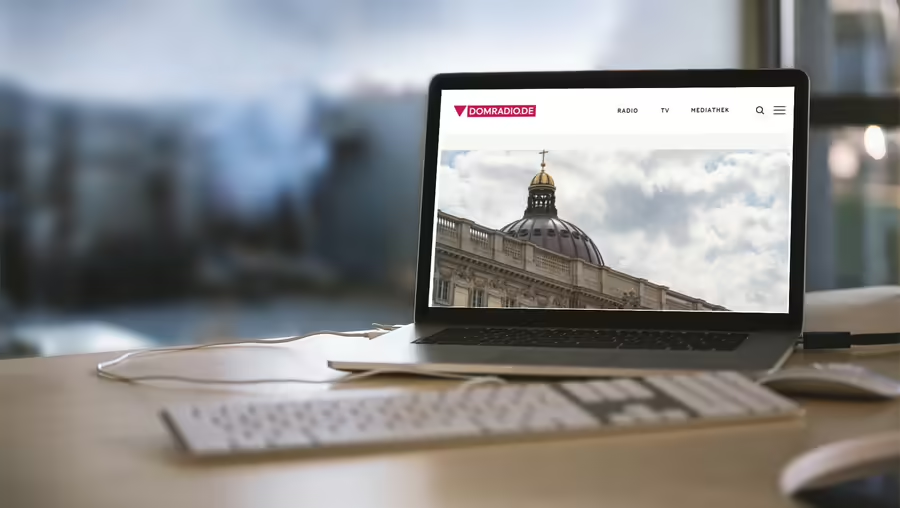
Share on