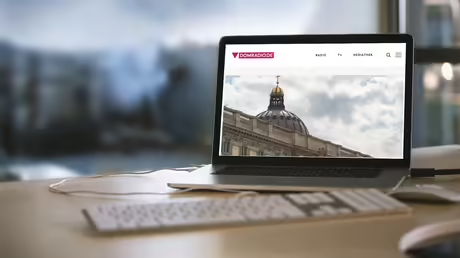Am Montag kamen in Graz Experten zu dem Thema zusammen. Zumindest in einigen Ländern wie in der Schweiz und Belgien seien Reformen ein Gebot der Stunde, so ihr Urteil. Andere Länder wie Deutschland würden mit dem etablierten System recht gut fahren.
Der Grazer Kirchenhistoriker Gerhard Hartmann unterstrich die Vorteile des deutschen Systems, wo die Kirchensteuer als sogenannte "Annexsteuer" durch einen etwa achtprozentigen Zuschlag zur Lohn- und Einkommensteuer erhoben wird. Die Mitglieder der betreffenden Kirchen finanzierten selbst ihre Kirche, nicht der Staat. Damit komme man auch dem Kirchenrecht nach, wonach die Gläubigen ihre Kirchen zu finanzieren haben. Die Anbindung an Lohn- und Einkommenssteuer bringe zweitens ein hohes Maß an Leistungsgerechtigkeit mit sich. Jeder werde gemäß seinen Möglichkeiten zur Steuer herangezogen.
Weiter betonte Hartmann die damit verbundene Unabhängigkeit der Kirche vom Staat - denn rein rechtlich seien es die Diözesen selbst, die den Beitrag erheben. Sie übertrügen diese Aufgabe lediglich über einen Art Dienstleistungsvertrag an den Staat. Die Kirche bekomme das Geld auch direkt und verwalte es. Allerdings, räumte Hartmann ein: Der deutsche Staat bekomme für diese Dienstleistung mit durchschnittlich drei Prozent der eingehobenen Summe ein viel zu hohes Entgelt. Trotzdem hält Hartmann das System für recht praktikabel: "Das deutsche Modell ist sicher kein Auslaufmodell."
Die Einführung eines Finanzierungsmodells wie in Italien ist für Hartmann nicht vorstellbar, weder in Deutschland noch in Österreich. Man müsse dafür eine neue Steuer einführen und auch jene 40 Prozent der deutschen Bevölkerung mit einer Steuer belasten, die keiner Kirche angehören. Das sei politisch nicht durchsetzbar.
Unabhängige Gemeinden in der Schweiz
Das italienische System "otto per mille" sieht vor, dass die Bürger bei ihrer jährlichen Steuererklärung selbst bestimmen können, ob sie acht Promille ihrer Einkommenssteuer für soziale und humanitäre oder religiöse und karitative Zwecke zur Verfügung stellen wollen. Mögliche Empfänger sind der Staat, die katholische Kirche und andere Religionsgemeinschaften, die mit dem Staat ein entsprechendes Abkommen getroffen haben.
Ein wesentlich anderes Kirchenbeitragsmodell hat die Schweiz. Aus den Kommunen ausgelagerte öffentlich-rechtliche Kirchgemeinden setzen jeweils die lokale Kirchensteuer fest und nehmen diese auch ein. Die Kirchgemeinden agieren unabhängig von der kirchlichen Diözesanleitung. Und aus ihren Töpfen werden dann Pfarreien und letztlich auch die Bischofshaushalte finanziert. Meist gibt es zwischen Kirchgemeinden und den Diözesen Übereinstimmung; bei Konflikten können die Kirchgemeinden bzw. die übergeordneten Landeskirchen und die Zentralkonferenz "sogar den Bischöfen den Geldhahn zudrehen," wie der Luzerner Kirchenhistoriker Markus Ries erläuterte.
Als großes Problem wies er auf den Umstand hin, dass auch Unternehmen - als juristische Person - Kirchensteuer zahlen müssen. Diese Bestimmung werde sich nicht mehr lange halten lassen. Schwierig sei es auch, gemeindeübergreifende Projekte in Angriff zu nehmen, da jede Kirchgemeinde in erster Linie nur bis zu ihrem eigenen Kirchturm blicke.
Alarmierend wertete Ries vor allem die stetig nachlassende Kirchenbindung. Den Großteil der Kirchensteuer leisteten schon jetzt Menschen, die der Kirche relativ distanziert gegenüber stehen. Das sei eine "Zeitbombe". Er glaube nicht, dass das derzeitige System noch zwei Generationen überleben werde, so der Kirchenhistoriker.
Kein Kirchenbeitragssystem in Belgien
Dass ein problembehaftetes Kirchenbeitragsystem aber immer noch besser sein kann als gar keines, machte der belgische Kirchenhistoriker Jan De Maeyer deutlich. Belgien kenne kein Kirchenbeitragssystem in diesem Sinn. Die Kirchen würden über verschiedene rechtliche Konstruktionen direkt oder indirekt vom Staat finanziert. Das System sei sehr komplex, und die Kirche habe weniger Spielraum als in anderen Staaten. Ständige Verhandlungen mit staatlichen Behörden zur Finanzierung kirchlicher Einrichtungen und Projekte seien notwendig.
Hinzu komme, dass die Gläubigen daran gewöhnt seien, dass der Staat für ihre Kirche aufkommt, betonte Maeyer. Er zeigte sich sehr skeptisch, dass die Gläubigen selbst für die Kirchenfinanzierung einspringen würden. Sein Fazit: Das derzeitige Finanzierungsmodell gerät immer stärker unter Druck. Die Verantwortlichen schöben Reformen aber auf die lange Bank.
Europäische Experten beraten über Alternativen
Kirchenfinanzierung unter Druck
So verschieden sich Europas Staaten in ihrer Identität und Tradition verstehen, so unterschiedlich sind auch ihre Modelle zur Kirchenfinanzierung. Kein System sei eins zu eins auf ein anderes Land übertragbar - so der Tenor bei der internationalen Tagung "Kirchenfinanzierung im Vergleich".
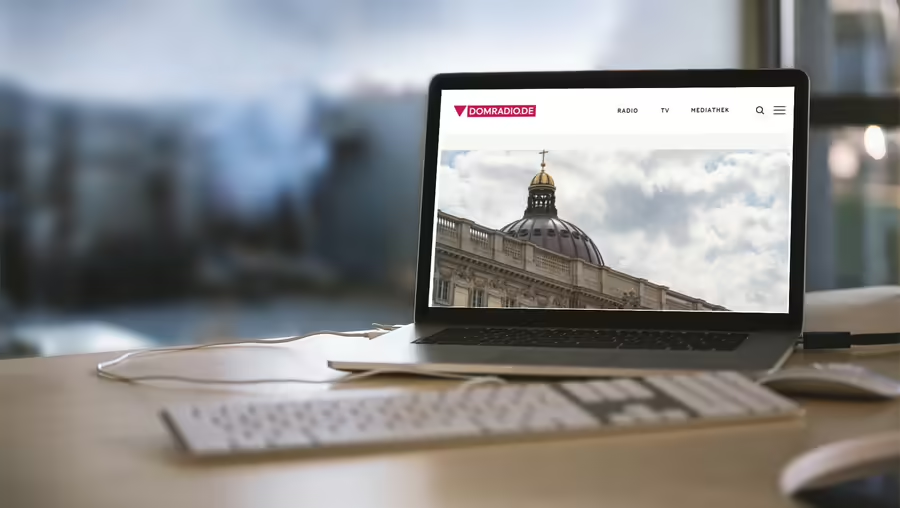
Share on