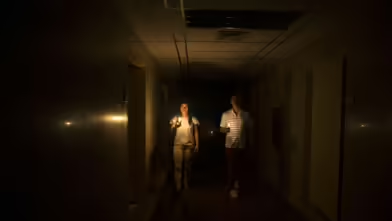DOMRADIO.DE: Sie haben ja Kontakt zu einer Krankenhausärztin in Venezuela und die berichtet im Moment von einer katastrophalen Versorgungslage. Wie ist denn die Situation dort?
Maria Lozano (Kirche in Not): Eine Ärztin hat mir eine Geschichte erzählt, die sie den Tag davor erlebt hatte, und sie war den Tränen nah, weil sie den Eindruck habe, dass wir nicht hier sind um Leben zu retten, sondern wir lediglich mittlerweile Sterbebegleitung machen. Sie berichtete von einem Vater, der mit seiner 10-jährigen Tochter, die eine Blinddarmentzündung hatte, ins Krankenhaus kam. Die Entzündung war schon so weit fortgeschritten, dass der Blinddarm perforiert war. Insofern war das eine große Infektionsquelle. Wenn man da keine Antibiotika nimmt, dann ist das Leben des Patienten in Gefahr. Der Vatter hatte aber kein Geld. Um die Medikamente zu bezahlen, müsste er in Venezuela acht Monate arbeiten, wenn man mit dem Mindestlohn rechnet. Der Vater saß in einer Ecke und kniete auf dem Boden mit den Armen an der Wand und betete. Insofern begleiten wir diese Menschen. Diese Geschichten kriegen wir sehr oft zu hören, denn die Menschen haben die Hoffnung fast verloren.
DOMRADIO.DE: Man merkt also, die Ärzte fühlen sich absolut hilflos. Wie kann diese Situation verbessert werden?
Lozano: Das ist natürlich eine ganz komplizierte Situation, vor allem weil auch Maduro im Moment sogar die kleine Gruppen, die sich um die Ordnung kümmern, in den Vierteln der Städte auffordert, sich zu bewaffnen. Sie stehen der Regierung von Maduro sehr nahe. Insofern sind die Leute auch ein bisschen in Panik. Ich habe gestern mit einem Bischof aus dem Osten des Landes gesprochen. Er hat mir gesagt, es gibt Dörfer im Bistum, die seit 30 Tagen keinen Strom mehr haben. Man muss dann bedenken, dass sie oft auch kein Wasser haben, weil die Pumpen nicht funktionieren. Die Menschen können sich nicht mal richtig fortbewegen. Die Folge ist, dass es große Plünderungen gab. Die Menschen sind bei anderen eingebrochen.
DOMRADIO.DE: Wie können Sie, wie kann Kirche in Not, denn da überhaupt vor Ort noch eingreifen und tätig werden?
Lozano: Wir haben in den letzten Jahren unsere Hilfe verfünffacht. Die Hälfte dieser Hilfe geht meistens an Nothilfe für Priester und Schwestern. Die Menschen kommen natürlich zu den Priestern, der ihnen dann zum Beispiel Lebensmittel gibt. Das heißt, unsere Hilfe kommt bei den Menschen an. Es herrscht eine große Depression im ganzen Land. Es gibt viele Menschen, die wirklich denken, das Leben hat keinen Wert mehr.
DOMRADIO.DE: Wenn wir nochmal zurückkommen zu der Geschichte, die sie ganz am Anfang erzählt haben, von dem Vater, der darum bangt, vielleicht das Antibiotikum für seine Tochter nicht zu bekommen. Wie kann jeder Einzelne denn helfen?
Lozano: Als Christ hier ganz weit entfernt, denke ich, kann man in erster Linie beten. Es ist wichtig für diese Menschen, sie in unser Gebet zu tragen. Eine finanzielle Hilfe ist natürlich sehr willkommen.
Das Interview führte Verena Tröster.