"Unsere Demokratie ist in großer Gefahr, aber wir sind etwas ratlos, wie man dem wirksam entgegentreten kann!" So oder ähnlich könnte man die zahlreichen Referate, Debatten und Wortmeldungen bei der Jahrestagung der Gesellschaft katholischer Publizistinnen und Publizisten (GKP) in aller Kürze zusammenfassen.

"Herausforderungen für die Demokratie" war die dreitägige Konferenz in Hannover überschrieben. Wobei Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) darauf hinwies, dass weltweit gesehen Demokratie "kein
Normal-, sondern eher der Ausnahmezustand" sei.
Denn von inzwischen rund 195 Staaten erfüllten nicht viel mehr als zwei Dutzend alle Ansprüche einer rechtsstaatlichen Demokratie, und in diesen lebten weniger als zehn Prozent der Weltbevölkerung. Seit dem Fall der Mauer und dem Sturz der autoritären Systeme in Mittel- und Osteuropa sei auch entgegen der damaligen Erwartungen die Zahl der Demokratien nicht größer, sondern kleiner geworden.
Kritischer Blick in die USA
Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen in den USA fügte der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung hinzu, diese hätten zwar die älteste geltende Verfassung der Welt, die bald ihren 250. Geburtstag feiern könne, doch zu den stabilen Demokratien könne man das Land unter Donald Trump leider nicht mehr zählen. "Die Amerikaner haben zwar die ältere, doch wir haben die bessere Verfassung", ergänzte Lammert. Vor allem weil diese sehr viel wehrhafter sei, da man im Gegensatz zu den US-Gründervätern zuvor den Zusammenbruch der Weimarer Demokratie erlebt und aufgearbeitet habe.
Mit einer Randbemerkung ging er auch noch auf die Begrenzung der Amtszeit des US-Präsidenten ein: George Washington als erster Amtsinhaber habe große Mühe gehabt, seinen Landsleuten klarzumachen, warum er nach zwei Amtszeiten abtrat. Und Trump? Dessen von vielen eher belächelte Überlegungen, "mit welchen Tricks er eine dritte Amtszeit herbeiführen kann, sollten wir sehr ernst nehmen".
Insgesamt - so Lammert und auch etliche andere Referenten - gehöre es zu den ganz großen, aber wohl kaum zu vermeidbaren Risiken jeder Demokratie, dass sie ihren Gegnern die Chance biete, sie anzugreifen, zu schwächen und sogar abzuschaffen. "Demokratie wird nicht durch die geschriebene Verfassung gesichert, sondern durch das gelebte Engagement von Demokraten", mahnte der 76-Jährige. So sei in der Weimarer Republik etwa das Bewusstsein einer gemeinsamen Verantwortung für die Demokratie zu schwach ausgeprägt gewesen, jedenfalls deutlich schwächer als die Rivalität der Parteien untereinander.
"Schwarz-rot kommt - und hält vier Jahre"
Eine Mahnung mit unverkennbar aktuellen Bezügen, auch wenn sich Lammert mit konkreten Ratschlägen für die aktuelle Regierungsbildung zurückhielt. Immerhin ließ er sich auf Nachfrage entlocken, dass er sowohl an das Zustandekommen einer schwarz-roten Regierung glaubt als auch an ein Durchhalten dieser Koalition bis zur Wahl 2029.

Der scheidende niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wählte in seinem schriftlichen Grußwort zum Auftakt der Tagung mahnende Worte. Die Frage, wie man Demokratie schützen und stärken kann, sei aktueller denn je - gerade in Zeiten von "zunehmender Polarisierung, wachsender Desinformation und populistischer Strömungen".
Weil lobte zugleich die katholische Kirche für ihren Einsatz gegen Populismus und für Demokratie: "Als Wertegemeinschaft, die sich auf Nächstenliebe, Gerechtigkeit und Solidarität gründet, hat sie eine große Verantwortung, für eine offene, friedliche und demokratische Gesellschaft einzustehen." Er sei der Kirche sehr dankbar, dass sie Halt und Orientierung gebe und sich aktiv gegen populistische Hetze positioniere.
Demokratie weltweit auf dem Rückzug
Generell sei derzeit die "funktionierende Demokratie" weltweit auf dem Rückzug, begann auch der Hamburger Politikwissenschaftler Peter Niesen seine Bestandsaufnahme zum Thema "demokratische Regression".
Von dieser spreche man zum Beispiel, wenn schwer erkämpfte Errungenschaften wie politische Gleichheit, Inklusion oder Menschenrechtsschutz zurückgedrängt würden, wenn Gewaltenteilung außer Kraft gesetzt oder der Medienpluralismus ausgehebelt werde.
Wobei viele dieser Dynamiken durchaus durch demokratische Wahlentscheidungen und eine breite Unterstützung der Bevölkerung legitimiert würden, wie man das etwa in den USA oder in Ungarn beobachten könne. Hinzu komme in Staaten wie USA, Türkei oder Ungarn das Phänomen einer "Oligarchisierung" von Demokratie, ergänzte Niesen. Hier sehe man, "wie persönliche und familiäre Bereicherung und demokratischer Verfall Hand in Hand gehen".
Probleme auch in Deutschland
Mit Blick auf die "stabile Demokratie" in Deutschland ergänzte er, er sehe auch hier ein Problem darin, "dass populistische Akteure stärker werden, die einen bestehenden demokratischen Konsens aufkündigen und ein völkisches Demokratieverständnis vertreten". Allerdings sei auch dabei festzustellen, dass kein Putsch, keine Revolution, sondern demokratische Wahlen mit ihren Ergebnissen dafür sorgten, dass die Demokratie in Gefahr gerate.
Demokratische Prozesse können mit ihren Risiken und Nebenwirkungen die Demokratie selbst gefährden - diese Feststellung zog sich wie ein roter Faden durch die Tagung. Das galt auch für Gespräche mit Sonja Anders, Intendantin des Staatstheaters Hannover, über ihr Engagement in der Initiative "Zusammen gegen den Hass" oder mit dem Hannoveraner Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), der unter anderem von zunehmenden Bedrohungen gegen Kommunalpolitiker berichtete.
Wie umgehen mit der AfD?
Auch die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack und Lena Bloemacher, Bundesvorsitzende des katholischen Jugenddachverbands BDKJ, berichteten von einer gewissen Ratlosigkeit angesichts zunehmender Gefahren für die Demokratie. Beide benannten hier ausdrücklich Probleme beim Umgang mit der AfD - ähnlich wie die Bischöfe Ralf Meister (Hannover, evangelisch) und Heiner Wilmer (Hildesheim, katholisch).
Zugespitzt gipfelten die Debatten in Fragen, wie lange man in Kirchen, Verbänden und Gewerkschaften die strikte Abgrenzung zu der zumindest in Teilen rechtsextremen Partei durchhalten kann und wie man mit deren Anhängern und deren zum Teil sicher berechtigten Sorgen umgehen will.
Wie kann man klare Kante zeigen gegen extreme Positionen und trotzdem offen bleiben für die Menschen, die entsprechend wählen? Was tun, wenn immer mehr AfDler auch in Betriebsräte gewählt werden? Ist es okay, einen großen Bogen um Veranstaltungen und ganze Regionen zu machen, in denen die Partei besonders stark ist? Was können Pfarreien und kirchliche Verbände in solchen Gegenden bewirken? Solche und ähnliche Fragen zeigten die Dilemmata auf, die vielerorts die Alltagsarbeit bestimmen.
Mehr Fragen als Antworten
Fragen gab es jedenfalls in diesem Zusammenhang deutlich mehr als Antworten. Von einem Parteiverbot rieten fast alle ab, denn dies könne zu einer weiteren Entfremdung von 20 bis 30 Prozent der Wähler von den demokratischen Institutionen führen. Und auch ständige Warnungen vor einer Abschaffung der Demokratie hätten in letzter Zeit - siehe etwa Kamala Harris oder die Grünen - nicht zu Wahlsiegen geführt.
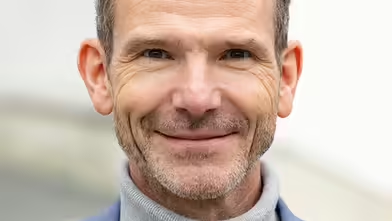
In einem Interview mit dem GKP-Vorsitzenden Joachim Frank zur Tagung versuchte sich Politikwissenschaftler Niesen schließlich doch noch an ein paar Lösungsvorschlägen - wohlwissend, dass auch diese Ansätze vermutlich keine raschen Wunder bewirken können: "Ich denke, dass politische Instrumente wie Infrastruktur sanieren, in Bildung investieren, Medienpluralismus sichern und politische Chancengleichheit stärken den autoritären Populismus eindämmen können und damit auch die demokratische Regression."



