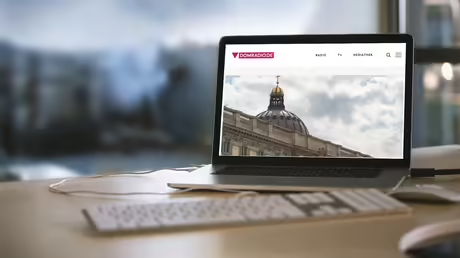Zwar geht ihm der Glamour-Faktor seiner Vorgängerin Margot Käßmann ab, die er nach Alkohol-Fahrt und Rücktritt Ende Februar plötzlich ersetzen musste, doch gelang es dem 63-Jährigen, das Schiff der EKD in ruhigere Fahrwasser zu steuern.
Schneider steht seit 2003 an der Spitze der Evangelischen Kirche im Rheinland, der mit 2,8 Millionen Mitgliedern zweitgrößten evangelischen Landeskirche in Deutschland. Seit seiner Zeit als Pfarrer in Duisburg-Rheinhausen von 1977 bis 1984 hat er vor allem das Image eines sozialpolitisch engagierten Geistlichen. Doch der in Duisburg aufgewachsene Sohn eines Stahlarbeiters ist auch ein solider Theologe, der seine Positionen - etwa zum Verbot einer christlichen Judenmission - pointiert, aber ohne verletzende Schärfe formulieren kann.
Verbindlicher und diplomatischer als Käßmann
Wo Käßmann eher polarisierte - etwa mit ihrem saloppen Spruch, von Papst Benedikt XVI. erwarte sie "nichts" für die Ökumene -, tritt Schneider verbindlicher, diplomatischer auf und sucht eher das Gemeinsame. Dies gilt nicht nur für das Verhältnis zu den Katholiken, sondern dürfte ebenso den Beziehungen zur russisch-orthodoxen Kirche nutzen, auch wenn Schneider sachlich im Blick auf die Fragen des Amtes in der Kirche und der Frauenordination keine anderen Auffassungen vertritt als seine Vorgängerin. Auch bei anderen Themen - etwa der innerprotestantisch wie ökumenisch umstrittenen Bewertung der Präimplantationsdiagnostik (PID) bei menschlichen Embryonen - zeigt er sein eigenes Profil, ähnlich wie sein Vor-Vorgänger, der Berliner Bischof Wolfgang Huber, bei der Stichtagsregelung für die Stammzellforschung.
Für die nach einer Wahl verbleibenden fünf Jahre als Ratsvorsitzender ist aus solchen einzelnen Äußerungen noch keine klare Handschrift erkennbar. Zunächst musste Schneider aus dem Stand die laufenden Verpflichtungen - nicht zuletzt ein umfangreiches Programm beim Ökumenischen Kirchentag in München - übernehmen. Außerdem gab er den Vorsitz des Diakonischen Rates und den Vorsitz des Aufsichtsrats des Evangelischen Entwicklungsdienstes (EED) ab.
Künftig will er, wie er ankündigte, "öffentlich offensiver auftreten". In der EKD wird er jedenfalls stärker eigene Akzente setzen müssen, etwa bei der Ausgestaltung der "Reformationsdekade" bis 2017 und beim Reformprozess "Kirche im Aufbruch" der deutschen Protestanten. Beides sind Projekte, die bereits der vorige Rat unter Führung des umtriebigen Wolfgang Huber angestoßen hat.
Schneiders rheinische Landeskirche hat ihren Reformprozess unter das Motto "missionarisch Volkskirche sein" gestellt - eine Formulierung, die auch ein persönliches Anliegen des Präses zum Ausdruck bringt: "Mission bewahrt die Volkskirche vor Unverbindlichkeit - Volkskirche bewahrt die Mission vor Enge und Realitätsverlust", brachte er es einmal auf den Punkt. In seiner Person bringt Schneider diese beiden Pole zusammen: Er kann herzlich und ungezwungen auf jedermann zugehen, ist auch als Kirchenoberer ein Seelsorger und volksnaher Prediger. Zu seiner Glaubwürdigkeit trägt auch sein Umgang mit eigenen Lebenskrisen wie dem Tod der jüngsten seiner drei Töchter vor fünf Jahren bei. Zusammen mit seiner Frau Anne verarbeitete er diese schmerzlichen Erfahrungen in einem Buch mit dem Titel: "Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist".
Präses Nikolaus Schneider bleibt EKD-Ratsvorsitzender
Kirchenmann mit Bodenhaftung
„Die Ökumene ist mir eine Herzensangelegenheit“, so Präses Schneider nach der Wahl zum neuen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland im domradio.de-Interview. Der rheinische Präses vertritt für die nächsten fünf Jahre fast 25 Millionen Protestanten in Deutschland. Nach seiner Wahl will er eigene Akzente setzen und etwa die Debatte um die Präimplantationsdiagnostik neu anstoßen.
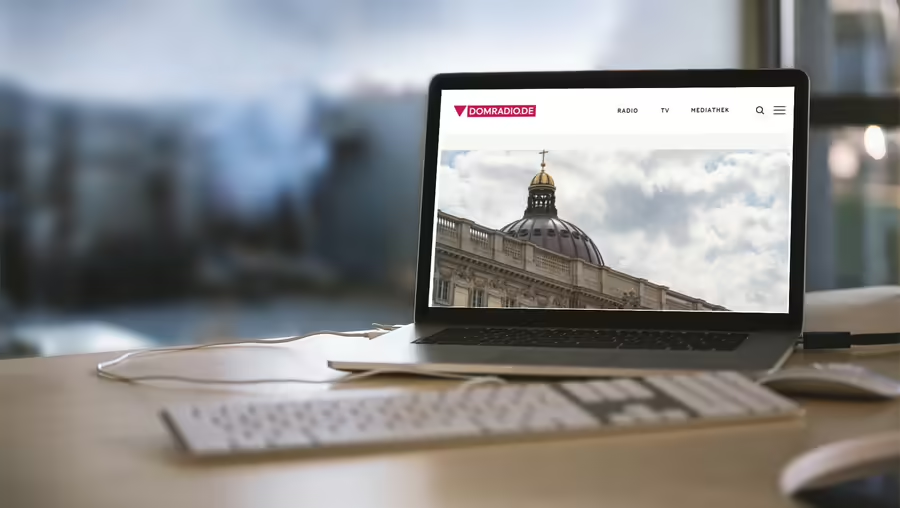
Share on