"Diese Ehrung", sagt Elazar Benyoetz, "gilt meinem Lebenswerk und bestätigt mir, dass ich mein Leben nicht vertan, mein Werk nicht versäumt habe." Die Freude ist ihm anzumerken. Der 75-jährige Israeli erhält am Dienstag in Berlin den Ehrenpreis der ökumenischen Stiftung Bibel und Kultur. Der Schriftsteller, so heißt es in der Begründung, "verleiht in einzigartiger Weise dem biblischen Wort, der deutschen Sprache und der jüdischen Kultur Ausdruck".
Und die Auszeichnung würdigt Benyoetz als Erneuerer einer Textgattung, den Aphorismus, jenen kurzen, philosophischen Sinnspruch, der mit wenigen Worten viel sagt. Geistreiches, Widerspenstiges, Anregendes, Aufschlussreiches, Geheimnisvolles, Tiefsinniges. Es ist eine Kunst, eine Sprach-Kunst. Und Benyoetz ist ein Meister dieser Kunst. Seine leisen Aphorismen, die doch so lange nachklingen, sind die passende literarische Form in Zeiten des laut tosenden medialen Sprach-Überflusses.
Zwei Pointen
Dabei birgt Benyoetz" Lebenslauf eine ganz eigene Pointe. Denn der in Wiener Neustadt unter dem Namen Paul Kloppel geborene Sohn einer jüdischen Familie, die 1938 vor den Nationalsozialisten floh, wuchs im damaligen Palästina mit Hebräisch als Muttersprache auf. Auf Hebräisch veröffentlichte er erste Lyrik-Bände. Die deutsche Sprache eignete er sich erst an, indem er Bücher von Emigranten kaufte und las. Ein Stipendium führte ihn 1964 zurück nach Deutschland, mit einer Empfehlung unter anderem des großen Martin Buber (1878-1965) im Gepäck. Seitdem schreibt er wieder in deutscher Sprache, seit 1969 fast ausschließlich. Seine große Liebe sei die hebräische Sprache, sagt Benyoetz, seine Geliebte sei die deutsche geworden.
Die Ehrung erfolgt nun in der Israelischen Botschaft in Berlin, und das ist eine weitere Pointe. Sie verweist auf dramatische Jahre des Autors. Die Zeit, in der er nach Deutschland kam, nennt er die "verbotenen Jahre" der israelisch-deutschen Beziehungen. "Ich wurde in Israel heftigst angegriffen und bald auch abgeschrieben. Das ist die eigentliche Wunde meines Lebens, vielleicht auch eine Quelle meines Schaffens", sagt Benyoetz. Ein Brief des israelischen Auswärtigen Amtes ermöglichte ihm 1964, in der "Israel-Mission" in Köln zu wohnen, aus der ein Jahr später nach der Aufnahme voller diplomatischer Beziehungen die Botschaft wurde.
Kandidat für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels
Benyoetz gab den Anstoß zur "Bibliographia Judaica", die den jüdischen Beitrag zur deutschen Geistes- und Zeitgeschichte bis zur Gegenwart aufarbeitet. Als er begann, würdigte Theodor W. Adorno das Projekt als "wichtigen und produktiven" Plan. Bis 1968 wohnte und forschte Benyoetz dafür in Berlin. Die Stadt ist für ihn "Moses Mendelssohn und der Ort meiner Verwandlung". Bis heute hat der nette ältere Herr mit dem weißen Bart, dem beobachtenden Blick und dem wachen Geist in Deutschland mehr Leser als in Israel.
Der Schriftsteller lebt in Tel Aviv und Jerusalem, vielleicht lebt er ein wenig mehr in der lebenslustigen Stadt am Meer und denkt eher in Jerusalem. Dort birgt seine Wohnstube eine der seltener werdenden Schatzkammern der Emigrantengeneration, gefüllt bis unter die Decke mit den deutschsprachigen Klassikern der Literatur. Bereits 1959 legte Benyoetz übrigens das Rabbinerexamen ab, ohne später als Rabbiner zu arbeiten. Seinen zuletzt erschienenen Werken merkt man diese rabbinische Prägung eher an als den Arbeiten der frühen Jahre. "Du kannst ohne Gott auskommen, aufgeben kannst du ihn nicht. Die Aufgabe steht am Ausgang", heißt es nun auch mal.
Benyoetz hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Die Ehrung der Stiftung Bibel und Kultur ist eine weitere und passt so wunderbar. Aber eigentlich ist er ein würdiger Kandidat für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Schließlich gab und gibt er der deutschen Sprache so viel zurück. "Dieses Deutsch", sagt er selbst, "wird von einem Israeli gemeistert, es hat seine Adresse und seinen Namen: das Jerusalemdeutsch".
Stiftung "Bibel und Kultur" ehrt Elazar Benyoetz
Der große leise Autor und sein "Jerusalemdeutsch"
Elazar Benyoetz ist einer der letzten israelischen Schriftsteller, die in deutscher Sprache schreiben. Nun wird der 75-Jährige von der ökumenischen Stiftung Bibel und Kultur für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Eine Ehrung mit Pointe.
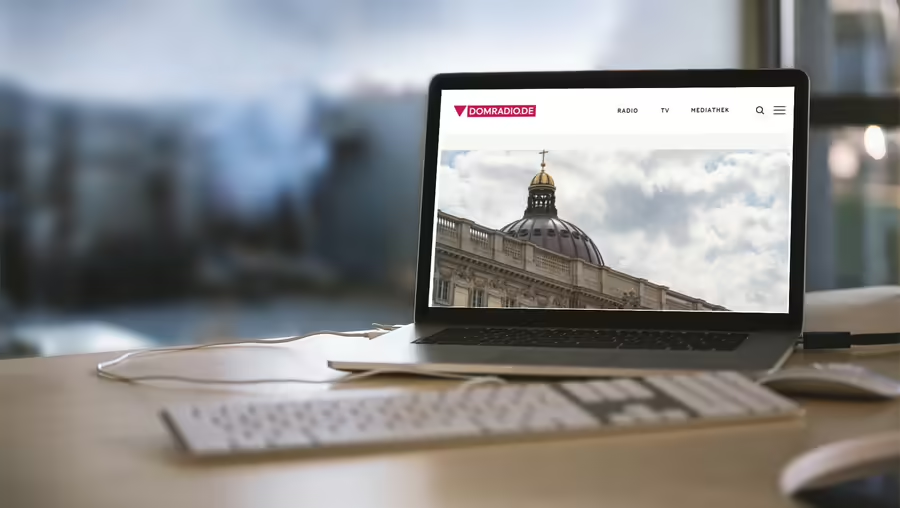
Share on

