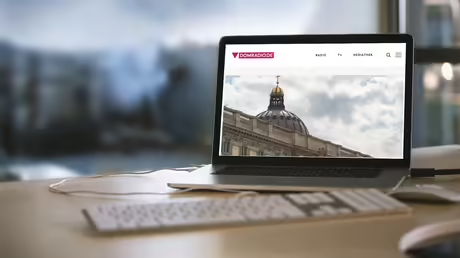Sie wirken auf den ersten Blick wie Überbleibsel aus einer anderen Zeit. Die Villen im Bonner Gründerzeitviertel mit ihren bunten Fahnen über dem Eingang, den knarzenden Dielenböden und rustikalen Zapfanlagen im Innern. Die Immobilien in zumeist bester Lage gehören den knapp 30 Studentenverbindungen der Stadt. Damit zählt Bonn zu den Hochburgen der Korporierten. Und wenn in diesen Tagen so viele Studenten wie noch nie zuvor an die deutschen Unis strömen, wird wohl auch der ein oder andere der über 7.000 Erstsemester in der Bundesstadt an die Türen der Verbindungshäuser anklopfen.
Zumindest auf dem Papier haben die Jungakademiker die Qual der Wahl. Da gibt es die "pflichtschlagenden" Burschenschaften und Corps, die noch die Tradition des studentischen Fechtens pflegen, Zusammenschlüsse von Sängern, Turnern oder weiblichen Studierenden und - als größte Gruppe - die katholischen Verbindungen. Sie alle eint eine bewegte Vergangenheit - und eine ungewisse Zukunft. In der Demokratie- und Nationalstaatsbewegung des frühen 19. Jahrhunderts stellten die zunächst protestantisch geprägten Bünde als Sammelbecken der Studenten die politische Avantgarde. Heute klagen viele von ihnen über Nachwuchssorgen. Konservative Kräfte geben den Ton an, die in Einzelfällen sogar rechtsradikale Positionen übernehmen.
"So etwas wirft uns zurück"
Sehr zum Leidwesen von Wolfgang Braun und Richard Weiskorn vom Cartellverband (CV). Sie verweisen auf die mit rassistischen Untertönen gefärbte Debatte in einem Teil der Burschenschaften über den Verbleib eines chinesischstämmigen Studenten in ihren Reihen. "So etwas wirft uns zurück", beklagen die beiden Vertreter der größten Dachorganisation katholischer Studentenverbindungen. Dem Zusammenschluss mit Sitz in Bad Honnef gehören aktuell 128 Einzelkorporationen mit rund 4.000 aktiven Mitgliedern und 25.000 "alten Herren" an.
Zwar stellen die Burschenschaften im Vergleich dazu nur eine Minderheit unter den Korporierten. "Aber in der Öffentlichkeit wird das alles in einen Topf geworfen", sagen Braun und Weiskorn. Gerade das Image der Ewig-Gestrigen wollen die CVer aber gerne ablegen. Der Verband präsentiert sich auf Messen für Abiturienten, unterhält eine eigene Akademie, in der unter anderem die im Berufsleben vielgefragten sozialen Kompetenzen vermittelt werden, und unterstützt die einzelnen Verbindungen bei der Öffentlichkeitsarbeit im Internet.
"Wir müssen künftig stärker nach außen unser inhaltliches Profil zeigen", lautet das Credo von CV-Pressesprecher Braun. Ziel sei es, "Persönlichkeiten zu formen, die aus dem katholischen Glauben heraus später in Beruf und Gesellschaft Verantwortung übernehmen". Ein Angebot, dass zumindest in den vergangenen Jahren wieder auf größeres Interesse stößt. Von etwas über 350 Neuzugängen im akademischen Jahr 1999/2000 stieg die Zahl auf zuletzt über 550. Nicht zuletzt der durch Xing und Facebook gepflegte Netzwerkgedanke der Generation Internet korrespondiert durchaus mit dem in Verbindungskreisen gepflegten Prinzip der lebenslangen Freundschaft.
Ganz andere Probleme
Wenn da nicht manche für den Außenstehenden zunächst befremdlich anmutenden Bräuche wären. Die "Kneipenabende" auf den Häusern, an denen der Alkoholkonsum beträchtliche Ausmaße erreichen kann, die "Vollwichs" genannten Galauniformen mit Stulpenhandschuhen und Paradeschlägern, die in farbentragenden Verbindungen bei festlichen Anlässen zum Einsatz kommen. Oder der hierarchische Aufbau, der zwischen Neulingen, den Füxen, den Inhabern diverser Ämter, den Chargierten, und den ehemaligen Studenten, den "alten Herren" unterscheidet. Für die Gießener Politologin Alexandra Kurth steht fest: "Gerade die vielen Regeln und der männerbündische Charakter hindern viele Verbindungen daran, im 21. Jahrhundert anzukommen."
Einstweilen haben die Korporierten freilich mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Schuld sind die stark gestrafften Studienzeiten. Raum für Verbindungsaktivitäten bleibt da kaum. Wegen verkürzter Schulzeiten dürften sich zudem künftig auch 16-Jährige für eine Aufnahme in die Verbindungen interessieren. Streng genommen müssten dann die Eltern mit auf den Paukboden zum Fechten oder zum geselligen Abend auf die Kneipe kommen. "In den nächsten 10 bis 15 Jahren wird sich die Landschaft noch grundlegend verändern", fassen Insider zusammen. Schon jetzt fällt der Unterhalt der Häuser manchen Verbindungen mangels Mitgliedern schwer. Und so dürfte in absehbarer Zeit auch vor manchem Bonner Bürgerhaus die Fahne für immer eingeholt werden.
Studentenverbindungen und der Erstsemesterboom an deutschen Unis
Zurück in die Zukunft
In diesen Tagen startet an deutschen Unis wieder der Semesterbetrieb - mit so vielen Studenten wie noch nie zuvor. Eine kleine Minderheit machte schon vorher Schlagzeilen: die Burschenschafter. Sie diskutierten über den Ausschluss eines Mitglieds aufgrund seiner chinesischen Abstammung und schlugen dabei bisweilen deutlich rechtsradikale Töne an.
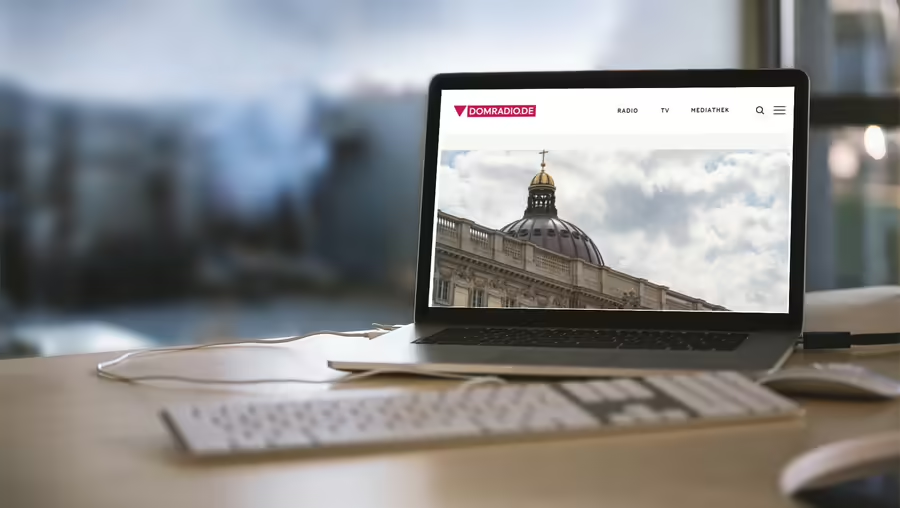
Share on