Um die Lebensgrundlagen für die Zukunft zu erhalten, habe man auch in Deutschland "noch sehr viel zu tun", mahnte Merkel weiter und forderte, den Flächenverbrauch hier zu Lande zu verringern. "Jeden Tag verbrauchen wir etwa 100 Hektar neuer Fläche und nehmen damit den Tieren und Pflanzen Lebensraum", beklagte die Regierungschefin. Dies müsse sich ändern.
BUND mahnt mehr Unternehmensverantwortung an
Die Ökosysteme des Planeten geraten zunehmend aus der Balance: Klimawandel, Waldvernichtung und Überfischung löschen jährlich Zehntausende Tier- und Pflanzenarten aus. 100 - 150 Arten sterben pro Tag aus, sagen die Experten, die auf der Weltnaturschutzkonferenz in Bonn über Maßnahmen gegen die fortschreitende Vernichtung beraten. Begleitet wurde der Auftakt der Veranstaltung von Protesten der Naturschützer.
Aktivisten des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) demonstrierten für den Erhalt seltener Arten. Mit großen weißen Holzkreuzen, auf denen die Namen von Tieren, deren Lebensräume durch die Tätigkeit deutscher und internationaler Unternehmen bedroht sind, stehen, wolle man den Scheinwerfer auf jene richten, die sich "hinter der Politik oder hinter geschönten Umweltbilanzen verstecken", sagte der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger.
Auf den Schildern mit durchgestrichenen Abbildungen dieser Tierarten werden namentlich der Energiekonzern Vattenfall, der Flugzeugbauer Airbus/EADS, die Chemiekonzerne BASF und Bayer, die Gentechnikunternehmen Monsanto und KWS Saat AG, die Baustofffirma HeidelbergCement und die Volkswagen AG genannt.
Lebensgrundlage geht verloren
Die Ökosysteme des Planeten geraten aus der Balance. Wenn nicht gegengesteuert wird, könnten bis Ende des Jahrhunderts 40 Prozent der Spezies ausgestorben sein, warnen die Vereinten Nationen. "Das Problem ist diese Geschwindigkeit", warnt Umweltexperte Michael Frein vom Evangelischen Entwicklungsdienst im domradio-Interview. Dringend nötige Fortschritte beim Artenschutz soll jetzt die neunte UN-Konferenz über biologische Vielfalt bringen.
"Die Abnahme von Arten ist ein ganz normaler Prozess", erklärt Frein. Das Tempo, in dem das geschehe sei jedoch "von Menschen gemacht" und kein Teil mehr des Evolutions-Prozesses. "Wir verlieren langsam die Grundlagen unseres Lebens."
Mehr als 5.000 Delegierte aus 189 Ländern werden zur Biodiversitätskonferenz vom 19. bis 30. Mai in Bonn erwartet. Ziel der Weltgemeinschaft: Bis 2010 soll der Artenschwund deutlich gebremst werden. Darauf haben sich die Vertragsstaaten der UN-Konvention über biologische Vielfalt vor sechs Jahren verständigt. Bislang aber "deutet alles daraufhin, dass dieses Ziel verfehlt wird", sagt Jörg Roos von der Umweltstiftung WWF. Umso größer sind die Erwartungen an die Beschlüsse des Bonner Gipfels.
Umweltexperten fordern Ausweitung der Schutzgebiete
Zu den zentralen Themen der Konferenz wird der Aufbau eines weltweiten Netzes von Naturschutzgebieten gehören. Denn Nationalparks und Biosphärenreservate sind das wirksamste Mittel zur Rettung der Arten. "Schutzgebiete sind das Rückgrat für den Erhalt der Biodiversität", sagt Konrad Uebelhör, Experte für biologische Vielfalt bei der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit.
Zwölf Prozent der Erdoberfläche sind derzeit unter Schutz gestellt, Umweltexperten fordern eine Ausweitung auf 25 Prozent. Das kostet Geld. Die Finanzierung von Schutzgebieten wird deshalb zu einer der entscheidenden Verhandlungspunkte in Bonn werden. Die meisten Arten sind in armen Staaten beheimatet, die für Naturschutz nur wenig Geld haben. "Die Entwicklungsländer drängen darauf, dass neue Mittel zur Verfügung gestellt werden", erklärt Uebelhör.
Artenschwund könnte Milliarden-Verluste verursachen
Bislang stellen Geberländer für den Erhalt der biologischen Vielfalt etwa sechs bis 10,5 Milliarden Euro im Jahr zur Verfügung - ein Betrag, der seit einigen Jahren stagniert. Der WWF schätzt, dass bis zu 40 Milliarden Euro jährlich nötig wären, um den Artenschwund tatsächlich zu bremsen.
Eine Investition, die sich lohnen würde. Denn der wirtschaftliche Verlust, der durch ungebremsten Artenschwund entstehen könnte, wäre wesentlich höher, meinen Umweltpolitiker und Naturschützer.
Bundesregierung und EU haben den Deutsche-Bank-Manager Pavan Sukhdev
beauftragt, die wirtschaftlichen Kosten des Artensterbens zu errechnen. Allein der Nutzen der weltweiten Schutzgebiete - etwa für die Trinkwasserversorgung - lässt sich nach ersten Ergebnissen der Sukhdev-Studie auf mehrere Billionen Euro im Jahr beziffern.
Ökonomische Bedeutung hat die Vielfalt der Arten und Ökosysteme auch
für die Pharmaindustrie: Etwa 50 Prozent der Medikamente in
Deutschland haben pflanzliche Grundstoffe. Eine reichhaltige Flora und Fauna gilt auch als unverzichtbar, um die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung zu sichern. Denn eine breite biologische Vielfalt erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Pflanzen- und Tierwelt an veränderte Umweltbedingungen anpasst.
Schwellenländer verlangen Schutz vor Biopiraterie
Neben Finanzierungsfragen wird voraussichtlich die kommerzielle Nutzung der Gene von Tieren und Pflanzen zum umstrittenen Thema in Bonn werden. Vor allem mächtige Schwellenländer mit hoher Artenvielfalt wie Brasilien wollen den Naturschutz nur dann voranbringen, wenn im Gegenzug verbindliche Regeln gegen "Biopiraterie" vereinbart werden.
Die Forderung: Pharma-Firmen etwa, die sich zur Herstellung von Arzneien aus dem Gen-Pool ärmerer Staaten bedienen, sollen von ihren Gewinnen abgeben - damit auch die Menschen dort von dem natürlichen Reichtum profitieren. Und ohne Zustimmung aus dem Herkunftsland soll die Patentierung pflanzlicher Wirkstoffe oder Erbanlagen verboten werden. "Das ist eine Frage der Gerechtigkeit", sagt Michael Frein, der zu dieser Problematik ein Buch verfasste. "Die Industriestaaten bewegen sich in dieser Frage aber nicht von der Stelle."
Umweltschützer hoffen, dass sich Gastgeber Deutschland für vorzeigbare Kompromisse in den umstrittenen Themenfeldern einsetzt. Umweltminister Sigmar Gabriel (SPD) ist sich aber bewusst, dass es ohne Anstrengungen aller Verhandlungspartner keine Erfolge geben wird: "Wir müssen aufpassen, dass nicht Mikado gespielt wird: Wer sich als erstes bewegt, hat verloren."
UN-Naturschutzkonferenz in Bonn - Merkel fordert mehr Naturschutzgebiete
Ökosysteme aus der Balance
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dringt auf einen Erfolg der Bonner Weltnaturschutzkonferenz. In ihrer wöchentlichen Video-Botschaft verwies die Kanzlerin darauf, dass auf der Welt derzeit etwa 16 000 Arten vom Aussterben bedroht seien. "Damit bringen wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen in Gefahr", warnte sie. Wenn die Konferenz ein Erfolg sein solle, müssten bis 2010 ein weltweites Netz ländlicher Naturschutzgebiete und bis 2012 ein Netz maritimer Naturschutzgebiete ausgewiesen werden. Nur so könne es gelingen, "den Schutz der Arten zu verbessern und das Sterben der Arten zu verhindern".
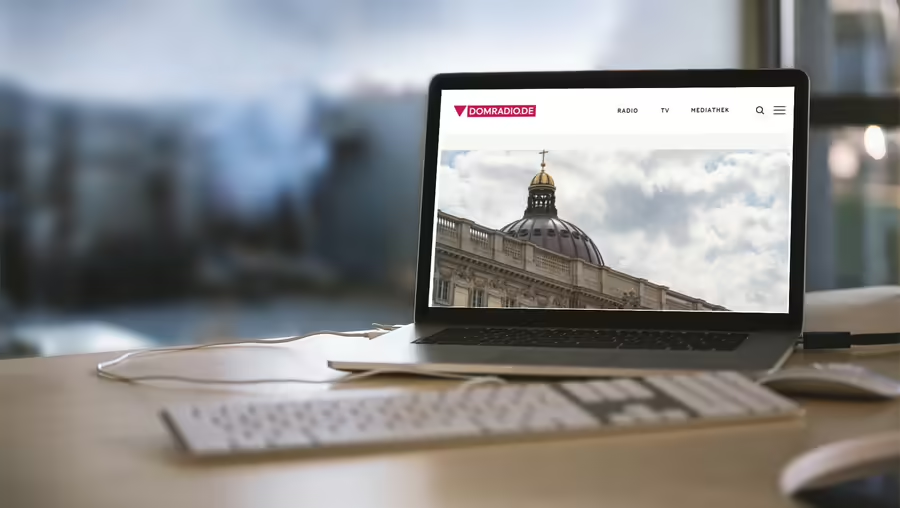
Share on
