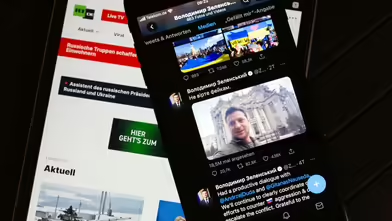Sophia Hösen sieht wieder alles ganz genau vor sich. Wie sie nächtelang mit ihrer Mutter im Keller gekauert hat und bei jedem Einschlag das gesamte Fundament erschüttert wurde. Wie sie ineinander verschlungen am ganzen Körper gezittert haben, bis die Sirenen nach jedem Luftangriff Entwarnung gaben. Und wie sie dann geradezu erleichtert feststellen, dass nur Brandbomben, keine Sprengbomben abgefeuert wurden. Ihr Langzeitgedächtnis lässt die 96-Jährige nicht im Stich. Im Gegenteil. Mit einem Mal sind die längst weggeschobenen Erfahrungen, die sie als junges Mädchen mitten in Kölns Kriegswirren machen musste, wieder da.
"Immer wenn Fliegeralarm war, sind wir Hals über Kopf aus dem dritten Stock die Treppe hinunter gerannt – mit ein paar wenigen Habseligkeiten für den Notfall, sollte uns über den Köpfen das ganze Haus weggebombt werden." Woche für Woche hätten sie so ausgeharrt – zwischen Hoffen und Bangen. "Trotzdem musste ich am nächsten Morgen wieder in die Schule, mir meinen Weg durch die in der Nacht zerstörten Straßen bahnen", berichtet die hochbetagte Frau. "Da hat niemand danach gefragt, ob man geschlafen hatte. Das war unser Alltag im Krieg: so zu tun, als ob das Leben nach jeder Schreckensnacht normal weiterginge. Irgendwann war ich davon so erschöpft, dass ich nicht einmal mehr die Sirenen gehört habe."
Auf Kisten hätten sie sich im bombensicheren Keller eine Art Lager zurecht gemacht. "Aber an Schlafen war gar nicht zu denken." Irgendwann sei dann die Holztreppe, die in die oberen Stockwerke führte, komplett ausgebrannt. "Da war uns klar, dass wir weg müssen. Mit unseren Fahrrädern, die zum Glück im Untergeschoss abgestellt waren, und dem wenigen, was wir retten konnten, sind wir dann zu Bekannten auf einen Bauernhof im Westerwald geflüchtet. In dieser Zeit hat jeder jedem geholfen." Später arbeitet die 18-Jährige im Büro einer Stahlgroßhandlung, die als kriegswichtiger Betrieb gilt, so dass sie nicht in den Arbeitsdienst muss. Im letzten Kriegsjahr schickt man sie sogar noch in eine Tochterfirma nach Thüringen. Angst sei in dieser Zeit zum ständigen Begleiter geworden: vor allem die Angst, dass der Vater den Krieg an der Front nicht überlebt, berichtet die gebürtige Kölnerin. "Immer wenn Post kam, waren wir beruhigt, ein Lebenszeichen von ihm zu haben."

1947 kommt der Vater, der schon im Ersten Weltkrieg kämpfen musste und auch gleich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wieder eingezogen wurde, aus französischer Gefangenschaft zurück. Ja, der Kriegsausbruch in der Ukraine bringe alle diese Bilder und Erinnerungen zurück, sagt Sophia Hösen. "Eigentlich wurde ich um meine gesamte Jugend betrogen. Sechs Jahre Krieg, in denen wir nicht wie normale Teenager aufwachsen konnten." Und trotzdem: Zu sehr dürfe sie das heute nicht mehr an sich heranlassen. "Das Kapitel Krieg habe ich vor langer Zeit für mich abgeschlossen, auch wenn er gerade wieder vor der Haustür steht und die Angst vor einem dritten Weltkrieg real ist", so die mehrfache Großmutter.
Erinnerungen nach 80 Jahren noch abrufbar
Evamarie Bode wird geboren, da ist Hitler gerade an die Macht gekommen. Ihre heutige Sehbehinderung schützt die inzwischen 89-Jährige vor den vielen verstörenden Bildern der Nachrichtensendungen, auf denen unter Schock stehende Menschen weinen, brennende Fassaden die Innenstädte verdunkeln, die qualmenden Wracks zerstörter Panzer am Wegesrand liegen und in immer erschütternderen Details das ganze Ausmaß des brutalen Zerstörungswerks russischer Angriffe auf die Zivilbevölkerung der Ukraine gezeigt wird. "Trotzdem habe ich genug Phantasie, mir auszumalen, was ich mit den Augen nicht mehr erkennen kann", sagt sie und ist froh, dass ihr die mangelnde Sehkraft zum Selbstschutz dient. Aufgewachsen in Prüm in der Eifel, bekommt Bode die Fronterlebnisse des Zweiten Weltkriegs dort hautnah mit. Gerade mal zwölf Jahre ist sie, als die Alliierten im Sommer ’44 in der Normandie landen und die erwartete Invasion kurz bevorsteht. "Nah an der Grenze zu Belgien hörten wir von Ferne das Rumoren der Kanonen. Wir dachten: ein gutes Zeichen. Nun ist der Krieg bald aus."

Als ganz besonders traumatisierend hat sie noch den Tieffliegerbeschuss in Erinnerung. "Kurz zuvor war in der Nachbarschaft ein Zug beschossen worden. Sieben Tote. Das Entsetzen war groß. Meine Schwester und ich spielten gerade mit unseren Puppen, als wir kurze Zeit später über uns Kampfflugzeuge hörten. Ich sehe uns noch mit dem Puppenwagen in den Keller eines Nachbarhauses stolpern, während knapp neben uns die Granaten einschlagen. Wir hatten Panik, verschüttet zu werden, doch am Ende großes Glück." Wenige Wochen später wird Prüm Ziel von amerikanischem Artilleriebeschuss. Im Dezember nehmen die Bombenangriffe vor dem Hintergrund der Ardennenoffensive zu. Die Stadt wird zu 80 Prozent zerstört.
Auch dass Goebbels nach dem missglückten Attentat auf Hitler am 20. Juli mit dem Lied "Heilig Vaterland" und seinen "Endsieg"-Parolen nochmals die Propagandamaschine aufdreht und die Widerstandskraft der Wehrmacht glorifiziert, obwohl sich ihre Niederlage bereits klar abzeichnet, hat die fast 90-Jährige noch abrufbar – als wäre das nicht knapp 80 Jahre her. Sie spricht von der sogenannten V1, der vom "Führer" gepriesenen "Wunderwaffe", einer riesigen Rakete, die große Krater ins Erdreich reißt, und von deren Nachfolgerin, der V2, die bei einer Geschwindigkeit von über 5.000 Stundenkilometern und 90 Kilometern Flughöhe eine Reichweite von 400 Kilometern hatte und noch einmal die Wende in dem eigentlich schon verlorenen Krieg bringen soll.
Bode erzählt von der Evakuierung mit wochenlanger Flucht nach Süddeutschland, von immer wieder Furcht einflößenden Soldatenansammlungen, in Flammen stehenden Ortschaften und von den Schreien ihrer Mutter, als sie die Nachricht vom Tod ihrer Eltern erreicht, die im Bombenhagel in Köln umgekommen sind. "Das war so schrecklich, dass ich es nie vergessen habe." Lange habe sie daran gearbeitet, diesen Teil ihres Lebens loszulassen, erklärt sie. "Das muss man, sonst verfolgt einen das für immer." Außerdem bete sie viel – nun aktuell für die Menschen in der Ukraine. "Damals in den Kellern haben alle gebetet. Das hilft. Im Gebet spüre ich, dass wir in einer anderen Welt aufgehoben sind", so die gläubige Katholikin. Und trotzdem: "Nachts kommt die alte Angst wieder hoch."
Verlust des Vaters wurde immer totgeschwiegen
Der Angriff Russlands auf die Ukraine lässt niemanden kalt. Aber in der Gruppe der über 80-Jährigen, die schon einmal einen Krieg erlebt haben, ist von einem Tag auf den anderen wieder sehr präsent, was längst bewältigt schien. Der Verlust von Heimat oder geliebter Menschen, die Bilder endloser Flüchtlingsströme von Osten nach Westen, der Hunger und die Perspektivlosigkeit bleiben eine Wunde, die sich niemals mehr ganz schließt. So ergeht es auch Marie-Luise Lohe.

Sie ist erst ein Jahr, als der Krieg ausbricht. Und als Kind erfasst sie auch in den Folgejahren nicht, was es heißt, dass eine ganze Welt in eine mörderische Auseinandersetzung verstrickt ist, die Millionen Menschenleben kostet. Das wird für sie erst greifbar, als es heißt: Der Vater kehrt aus dem Krieg nicht mehr heim. Irgendwo im weißrussischen Niemandsland verliert sich seine Spur. Er bleibt zeitlebens vermisst. Auch die Suche über das Rote Kreuz kann die näheren Umstände nicht klären. Sie bleibt erfolglos – und die Mutter mit zwei kleinen Kindern in den Trümmern zerstörter Zukunftshoffnungen zurück.
Noch heute kämpft die 84-Jährige mit den Tränen, wenn sie sich die Situation abruft, in der sie den Vater ein letztes Mal lebend sieht. Der Schmerz nach diesem Abschied, der endgültig bleibt, was sie mit ihrem kindlichen Horizont lange nicht erfasst, hat ihr Leben geprägt. Bei dem letzten Heimaturlaub ihres Vaters liegt die Fünfjährige wegen Diphterie im Krankenhaus. Hinter einer Fensterscheibe, die sie von ihrer Familie isoliert, hört sie die ältere noch Schwester rufen: "Papa muss wieder in den Krieg." Das sollte ihre letzte Begegnung mit ihm sein. Später sei der Verlust des Vaters zuhause tot geschwiegen worden, die Trauer innerhalb der Familie nie bearbeitet worden – "so etwas wie psychologische Hilfe oder Trauerbegleitung gab es früher ja nicht". Weihnachten habe die Mutter immer geweint. "Da war der Vater dann wieder sehr präsent. Nur gesprochen wurde über ihn nicht." Als Marie-Luise sieben ist, endet der Krieg. Da ist sie mit Mutter und Schwester im Sudetengau, den vom Deutschen Reich einverleibten Gebieten der Tschechoslowakei. "Trotzdem war mit dem Kriegsende das Grauen nicht vorbei. Nun kamen nachts die Russen und Polen, die die Frauen vergewaltigten. Das bekamen selbst wir als Kinder schon mit. Es war furchtbar."
Der kleine Bruder stirbt auf der Flucht
Auch Schwester Helga Mateina, Pallottinerin und viele Jahre Seelsorgerin im Refrather Alten- und Pflegeheim St. Josefshaus, trägt wie so viele eine unsichtbare Narbe mit sich herum. Mit ihren heute 81 Jahren kennt sie die meisten Kriegsereignisse nur aus Erzählungen. Doch die dramatische Flucht ihrer Familie aus dem ermländischen Allenstein in Ostpreußen, als sie gerade mal drei Jahre alt ist, hat sich schon früh in ihr Bewusstsein eingebrannt. Sowie Erinnerungen an die Nahkämpfe auf den Straßen – "das war das Schlimmste" – aber auch daran, wie der Vater die Pferde schlägt, um den Treck mit den Planwagen anzutreiben und noch rechtzeitig Richtung Königsberg zu entkommen, als sie schon von den Russen umzingelt sind. Oder daran, wie sie beim Blick zurück die brennende Stadt sehen – "ein gespenstisches Bild" – das sie bis heute in Kopf und Herz trage. "Vor allem aber weiß ich noch, dass mein kleiner Bruder Georg mit seinen sechs Monaten unentwegt schrie. Dabei mussten wir uns doch oft auf verlassenen Bauern- und Gutshöfen verstecken, und sein Geschrei brachte uns in große Gefahr." Bis es nach drei Monaten Flucht eines Tages in diesem eiskalten Januar ’45 plötzlich ganz still ist. "Dann habe ich den gellenden Schrei meiner Mutter gehört, die ein lebloses Baby in ihren Armen hielt. Mein Brüderchen Georg war erfroren."
In Gdingen, nahe Danzig, treiben die Eltern einen kleinen weißen Sarg auf, in dem sie das Kind unterwegs bestatten. "Auch wenn wir diese traurige Erfahrung wie all das Furchtbare, was wir im Krieg erlebt haben, weggepackt haben, hat uns das geformt", weiß die Ordensfrau heute in der Rückschau auf diese Zeit. "So sehr, dass ich mich zeitlebens als Flüchtlingskind gefühlt habe, immer ein unruhiger Geist war und das in dem Bewusstsein: Ich bin nichts, kann nichts, hab nichts." Eine Haltung, die manchmal mit depressiven Stimmungen einhergehe. "Bis heute begleitet mich der Gedanke, von vielen Möglichkeiten ausgegrenzt gewesen zu sein." Nicht von ungefähr habe sie viele Jahre den Beruf der Sonderschullehrerin ausgeübt. "Da war ich endlich angekommen. Das war meine Welt: für Kinder da sein, die Unterstützung brauchen, um sich zurechtzufinden. Wie ich damals." Feuer, Alarm, Sirenen, Munitionssalven, Soldaten – alles das wiederhole sich für sie gerade im Ukraine-Krieg und sorge für erneutes Erstarren und pure Angst, dass im nächsten Moment wieder etwas unerwartet Schreckliches geschehe. "Das Schreien und Weinen, aber auch die Ohnmacht und Hilflosigkeit von damals sind wieder da."