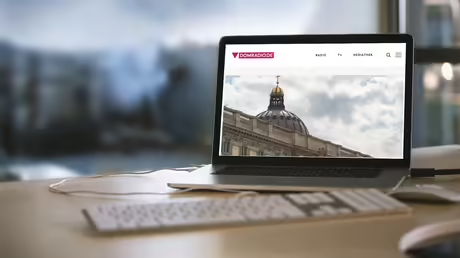Anfang Februar wurde in Washington auf Plakaten bei der "Konservativen Politischen Aktionskonferenz", einem Treffen der politisch rechten Bewegung, vor seiner Wahl sogar gewarnt. Er werde auf keinen Fall für McCain stimmen, versicherte James Dobson, der Chef des evangelikalen Verbandes "Focus on the Family". Dobsons Kommentare sind in zahlreichen US-Rundfunksendern zu hören.
Seit Ronald Reagan 1980 ist ohne die konservativen Christen kein Republikaner Präsident geworden. Weiße Evangelikale stellen etwa ein Viertel der US-Bevölkerung. 2004 stimmten 78 Prozent für George W.
Bush. Eigentlich hat der 71-jährige McCain die republikanischen Vorwahlen längst gewonnen. Er verfügt über 960 Delegierte, sein einzig verbleibender Konkurrent Mike Huckabee hat 245.
Aber der Ex-Gouverneur von Arkansas und ehemalige Baptistenpastor Huckabee symbolisiert, dass McCain nicht die Sympathien der gesamten Partei genießt. Der volkstümliche "Huck" ist der Darling der Wähler an den konservativ-christlichen Graswurzeln. Und anscheinend wird er den Weg zumindest vor den Vorwahlen in Texas am 4. März nicht frei machen. Man kämpfe doch nicht nur "um zu gewinnen, sondern auch, weil man glaubt, recht zu haben", sagte Huckabee vergangene Woche.
McCain gilt als manchmal unberechenbarer Querdenker
Obwohl McCain im Senat meist für konservative Anliegen eintritt, geht er führenden Vertretern rechter Verbände auf die Nerven. McCain gilt als manchmal unberechenbarer Querdenker. Er stimmte gegen einen Verfassungszusatz zum Verbot der Homoehe - laut McCain unnötig - für ein Wahlfinanzierungsgesetz, das nach Ansicht von Kritikern religiöse Verbände behindert, und er würde vermutlich die Stammzellenforschung liberalisieren.
Zudem sei McCains Wortwahl oft "obszön und schmutzig", jammerte Dobson. Die christlichen Rechten haben ein Elefantengedächtnis. Man hat es McCain nicht verziehen, dass er 2000 im Vorwahlkampf (McCain unterlag George W. Bush) die Fernsehprediger Jerry Falwell und Pat Robertson als "Agenten der Intoleranz" geißelte. Und McCain fällt es anscheinend schwer, die erforderlichen Kniebeugen zu machen. Er spricht wenig über seinen Glauben.
McCain kam auf einem US-Militärstützpunkt in der Panamakanalzone zur Welt. Sein Vater und Großvater wären Admirale in der Marine. Man gehörte der Episkopalkirche an. Obwohl er nun eine Baptistengemeinde besucht, sei er kein wiedergeborener Christ, sondern "nur ein Christ", erläuterte McCain vergangenen Herbst in der Zeitung "Christian Science Monitor" in einem seiner seltenen Interviews über seinen Glauben.
Mit Hilfe seines Glaubens habe er seine in den USA legendäre fünfeinhalbjährige Kriegsgefangenschaft in Vietnam überstanden.
McCain wurde 1967 bei einem Bombenangriff auf Hanoi abgeschossen und in Gefangenschaft gefoltert. Vertrauen auf Gott, auf die Nation und auf die Mitgefangenen seien entscheidend gewesen, um diese Zeit zu überstehen, schrieb McCain in seinen Erinnerungen ("Faith of My Fathers").
Von George W. Bush lernen
Nach Ansicht des Religionsexperten John Green vom Meinungsforschungsinstitut "Pew Forum on Religion and Public Life" könnte McCain nun von George W. Bush lernen. Dieser sei 2000 anfangs auch nicht Wunschkandidat prominenter Konservativer gewesen. Bush habe aber mit seinen Reden eine Beziehung zu evangelikalen Wählern aufgebaut und die Führung "umgangen".
Der Religionshistoriker Randall Balmer erklärte kürzlich im Rundfunk, er könne sich nicht vorstellen, dass die Evangelikalen am Wahltag im November nicht mehrheitlich für den republikanischen Kandidaten und gegen die Demokraten Hillary Clinton oder Barack Obama stimmen würden. Fraglich sei allerdings, ob unzufriedene Evangelikale nicht lieber ganz zu Hause bleiben.
Dass konservative Republikaner und rechte Christen sich um den republikanischen Kandidaten scharen, wenn dieser von links angegriffen wird, zeigt sich auch gegenwärtig bei der Debatte über einen Artikel in der liberalen "New York Times" über McCains angeblich enge persönliche Beziehungen zu einer Lobbyistin. Das sei schändlicher Skandaljournalismus, wettern Republikaner aller Schattierungen.
Von Konrad Ege (epd)
Der Republikaner John McCain und sein gestörtes Verhältnis zu den Evangelikalen
Von Bush lernen, heißt Religionsnähe lernen
Außenstehende mag es verblüffen: Der republikanische Präsidentschaftsanwärter John McCain - engagierter Abtreibungsgegner, Befürworter der US-Irakpolitik und Kriegsheld - hat Schwierigkeiten mit konservativen Parteimitgliedern und der christlichen Rechten. Ohne sie wird es schwer für McCain, Präsident zu werden. Nun heißt es: von George W. Bush lernen.
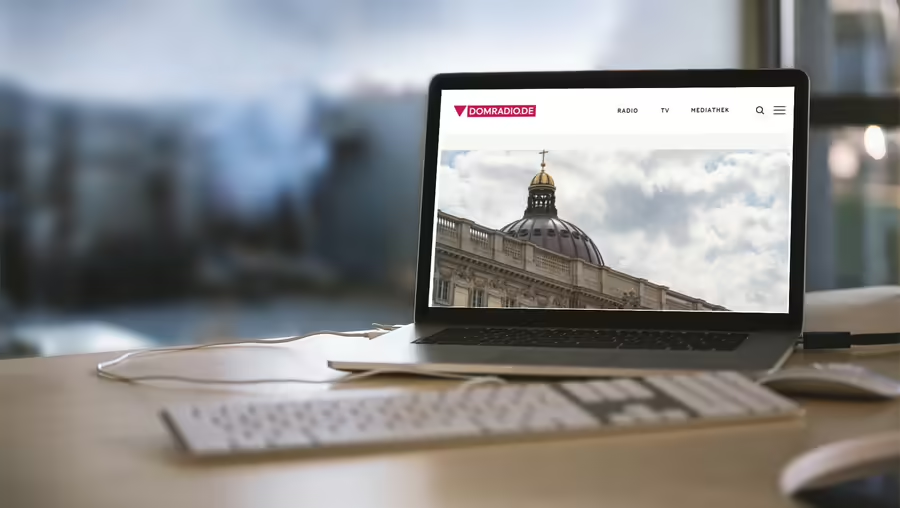
Share on