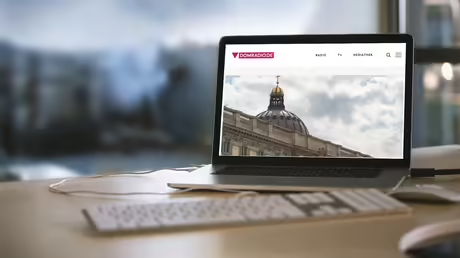Die Aufgabe hat die frühere Bundesfamilienministerin viel Kraft gekostet. Sie habe von Leidenswegen erfahren, die "ich mir in diesen Ausmaß so nicht habe vorstellen können", sagte die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung vergangene Woche der Hamburger Wochenzeitung "Die Zeit". "Das hat mich persönlich sehr mitgenommen."
Seit März 2010 sind bei Bergmanns Anlaufstelle rund 15.000 Anrufe, Mails und Briefe eingegangen. Mehr als 60 Prozent der Fälle seien im familiären und sozialen Umfeld passiert, berichtet die 71-Jährige. Bei den Institutionen liege die katholische Kirche mit 45 Prozent aller Fälle vorn.
Für Bergmann steht fest: "Missbrauch dauert oft ein ganzes Leben lang, auch wenn die Taten selbst schon längst vorbei sind." Das Gefühl der Ohnmacht lasse die Opfer nicht mehr los, dringe in ihre Beziehungen und ihre Familien ein und raube ihnen das Urvertrauen in andere Menschen. Für über die Hälfte der Anrufer sei es das erste Mal gewesen, dass sie über den erlittenen Missbrauch gesprochen hätten, berichtet sie. "Die Wunden sind oft immer noch offen."
Konkrete politische Maßnahmen
Mehrfach hat sich die frühere Familienministerin für konkrete politische Maßnahmen ausgesprochen: Neben mehr Beratung und finanziellen Hilfen für Therapien wünschten sich die Opfer aber auch die Anerkennung ihres Leides. "Sie wollen, dass die Täter ihre Schuld zugeben, Institutionen ihr Versagen eingestehen und Verantwortung übernehmen", sagt sie. Dazu müsse eine bessere Vorbeugung kommen, etwa durch Fortbildung und Sensibilisierung von Verantwortlichen in Vereinen, Kindergärten und der Jugendhilfe. Beim umstrittenen Thema Anzeigenpflicht verweist sie darauf, dass sowohl die Betroffenen als auch die Beratungsstellen deutlich dagegen sind. Die Verfahren seien für die Opfer oft so aufreibend und traumatisierend, dass sich im Fall einer Anzeigenpflicht viele Betroffene aus Angst nicht melden würden.
Die heftig diskutierte Entschädigungsfrage hält die SPD-Politikerin für äußerst kompliziert. Im März hatte Bergmann dem Runden Tisch einen gemeinsamen Hilfsfonds für die Opfer sexuellen Kindesmissbrauchs empfohlen. Die Fondsmittel sollten vor allem in die Bereiche Therapie und Beratung fließen, könnten aber auch Entschädigungszahlungen und Härtefallregelungen umfassen, sagte sie. Konkrete Zahlen zum finanziellen Umfang nannte sie allerdings nicht. Im "Zeit"-Interview präzisierte sie, dass neben den beteiligten Institutionen auch der Staat Entschädigungen anbieten müsse. Die Regierung sei "ganz klar mit in der Pflicht, gerade wenn es um Hilfe für lange zurückliegende Fälle geht und für Menschen, die in ihren Familien missbraucht wurden."
500.000 Euro für einen "Präventionsfonds"
So vage Bergmanns Vorschläge bei den Entschädigungssummen bleiben, so fest umrissen ist das Konzept, das die Deutsche Bischofskonferenz schon im vergangenen Herbst beschlossen hat - als erste der am Runden Tisch beteiligten Institutionen. Katholische Einrichtungen zahlen Opfern sexueller Übergriffe bis zu 5.000 Euro, wenn diese ihre Ansprüche wegen Verjährung vor Gericht nicht mehr durchsetzen können. Zusätzlich übernimmt die Kirche die Kosten für eine Psychotherapie. In besonders schweren Fällen kann auch eine höhere Entschädigungssumme gezahlt werden.
Außerdem will die Kirche 500.000 Euro für einen "Präventionsfonds" bereitstellen. Damit verbunden ist zunächst einmal die Absage an einen eventuellen gemeinsamen Fonds zur Übernahme von Therapiekosten, wie ihn Bergmann und Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) favorisieren. Die Kirche verweist darauf, dass bereits "seit geraumer Zeit" Orden und Bistümer derartige Kosten übernähmen, sofern diese nicht durch die Krankenkassen finanziert würden.
Missbrauchsbeauftragte Bergmann legt Abschlussbericht vor
"Das hat mich sehr mitgenommen"
Im März 2010 hatte die Bundesregierung Christine Bergmann damit beauftragt, die zentrale Anlaufstelle für Missbrauchsopfer zu leiten und dem Runden Tisch der Bundesregierung zum "sexuellen Kindesmissbrauch" Empfehlungen zu unterbreiten. Am Dienstag legt die SPD-Politikerin ihren Abschlussbericht vor.
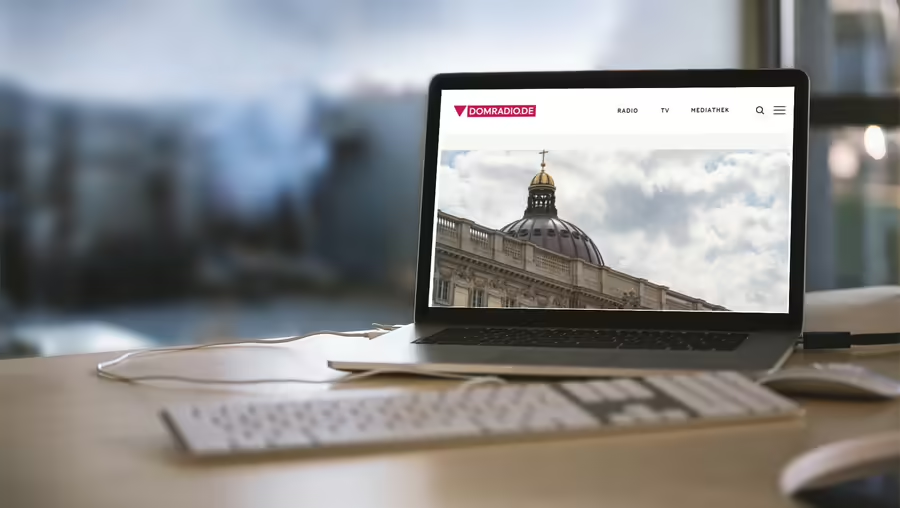
Share on