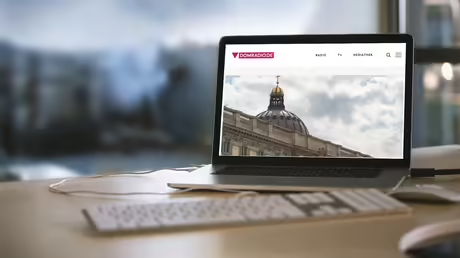"Ich bin gegen das Mohammed-Video, aber genauso bin ich gegen Gewalt als Reaktion darauf", sagt Timour Mustafa Heikal. Der 23-jährige Wirtschaftsstudent der Kairoer Al-Azhar-Universität engagiert sich seit 2010 in der "Bewegung des 6. April", die die Revolution mit anstieß und dabei von Neuen Medien profitierte. Er ist selbst bei Facebook und Twitter unterwegs. Die schnelle Kommunikation findet er gut. Soziale Netzwerke hält er aber auch für glaubwürdiger als herkömmliche Medien. Doch woran macht er fest, was er glauben kann und was nicht?
"Wir sind frei, wir können schreiben, was wir wollen", sagt die Journalistin Rawda Fuoad, die bei dem halbstaatlichen "6th October Magazine" arbeitet. Endlich könne sie die Schere im Kopf ausschalten, überall anrufen, um zu recherchieren. Junge Ägypter wie Timour wollen solchen medialen Aussagen allerdings nicht trauen. Im Netz könne alles von allen gelesen und kontrolliert werden, sagt der 23-Jährige. So prüfe er die Glaubwürdigkeit. Dass viele Menschen genauso irren können, irritiert ihn nicht.
Auch Mira, Kenzy und Menna trauen den staatlichen Medien bis heute nicht. Die drei 17-Jährigen sprechen fließend Deutsch und Englisch. Sie gehen in die Deutsche Schule der Borromäerinnen, eine Privatschule mit beheiztem Hallenbad, Foto-AG und Klassenfahrten ins bayerische Voralpenland. Rund 2.000 Euro zahlen ihre Eltern pro Schuljahr - für Bildung, die sich lohnt. Auf dem Land unterrichte ein Lehrer oft bis zu 80 Schüler, sagt Kenzy. Da sei es schwer, den Kindern kritisches Denken beizubringen. Hauptsächlich werde auswendig gelernt.
Die Mädchen hingegen hinterfragen viel: Eine Plakataktion des Militärs, auf der ein Soldat ein Baby im Arm wiegt, empfinden sie als Schönfärberei. Dass Zivilisten vor Militärgerichte gestellt wurden, empört sie. Und die staatlichen Medien haben sich ihrer Meinung nach bis heute nicht verändert. Sie informieren sich lieber über soziale Netzwerke und ausländische Onlinezeitungen.
Ein Privileg, von dem Mustafa Ahmed Abd El Gaber nur träumen kann. Von sozialen Netzwerken ist der 19-Jährige mindestens so weit entfernt wie vom Tahrir-Platz, wo die Revolution ihren Lauf nahm. Er lebt draußen im Caritas-Jugendheim Kafr El Sissi im Kairoer Stadtteil Giza. Immerhin, eine E-Mail-Adresse hat er. Twitter und Facebook aber nutzen die Kinder und Jugendlichen im Heim laut Caritas-Chef Magdy Garas nicht.
"Sie spielen mit dem Computer", sagt er und zeigt dann, wie die Kinder wild auf die Tastatur tippen. Viele von ihnen können kaum lesen und schreiben. Die Schule haben manche jahrelang nicht besucht. Viele haben sich auf der Straße durchgeschlagen, Drogen genommen. In dieser Ecke Kairos wird sichtbar, warum sich Ägypten in Sachen Pro-Kopf-Einkommen auf Platz 134 der UN-Liste findet. Der Tahrir-Platz mit seinen Bloggern und dem Coffee-to-go scheint plötzlich weit weg.
Weit weg von Kairo war auch Mohammed El Khalergy. Der 22-Jährige hat Zahnmedizin studiert; nun ist er arbeitslos wie jeder vierte junge Ägypter. Aber nicht seine Misere war der Grund dafür, dass er für Demokratiebildung durchs Land zog. Es gehe ihm ums Prinzip, sagt er. Manche Ägypter verdienten umgerechnet fast 200.000 Euro im Monat, andere nur 150, empört er sich und fordert Einkommensgrenzen - für alle. Vor den Parlamentswahlen hat er Landsleute über Demokratie informiert - und zwar offline. Wochenlang ist er mit der Friedrich-Ebert-Stiftung durch Ägypten gereist; auch dorthin, wo zwar jeder von Facebook und Twitter gehört hat, es aber nicht nutzt. Weil es keinen Internetzugang gibt.
Wie junge Ägypter mit Medien umgehen
Die Facebook-Generation
Youtube, Facebook, Twitter: Neue Medien haben sowohl bei der ägyptischen Revolution als auch bei den jüngsten Protesten gegen die Mohammed-Schmähvideos eine große Rolle gespielt. Ihre Bedeutung in Ägypten hat seit dem politischen Umbruch nicht abgenommen. Trotzdem erreichen Facebook und Co längst nicht alle jungen Ägypter.
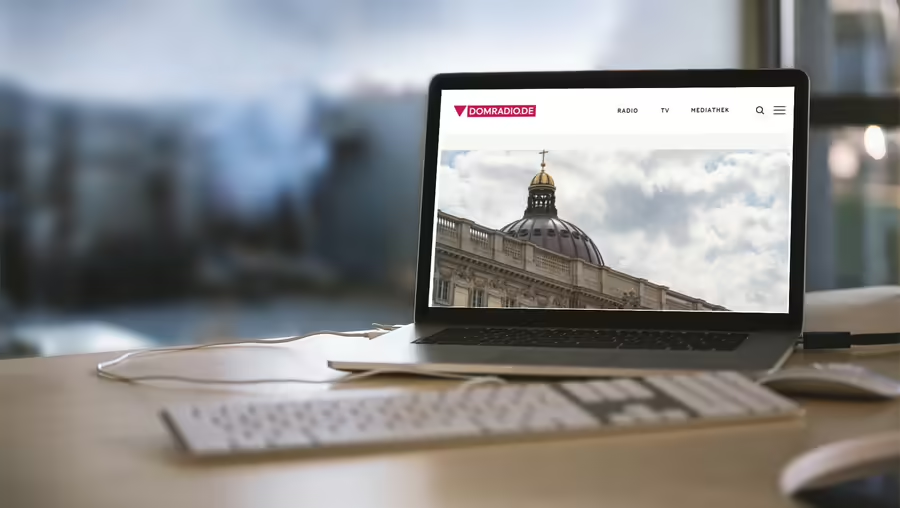
Share on