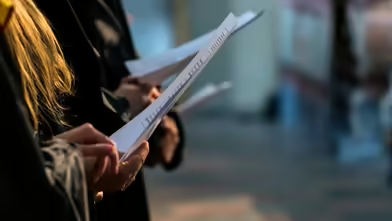KNA: Herr Weber, Sie befassen sich in ihren Publikationen mit allen Schattierungen des Lebens. Haben wir durch Corona das Leben wieder mehr schätzen gelernt?
Andreas Weber (Philosoph und Biologe): Ich glaube nicht, auch wenn es ein guter Anlass wäre, genau das zu tun. Uns vom Leben wieder mehr berühren zu lassen, das könnte eine gute Lehre aus Corona sein. Aber zuvor müssten wir eine radikale Kehrtwendung vollziehen und uns von der Betäubung, die durch den Konsum von Waren, Urlaubsreisen oder auch durch andauerndes Arbeiten - entsteht, abwenden. Nur so können wir den Augenblick - im Schönen wie im Schmerzlichen - und das, was gerade wirklich passiert, erfahren und uns darauf einlassen.
KNA: Was hindert uns daran?
Weber: Wir müssten uns dann auch wieder mit dem Tod konfrontieren, also mit dem Umstand, dass alles ein Ende hat. Aber das sind wir überhaupt nicht mehr gewöhnt. Wir versuchen als Gesellschaft, den Tod möglichst auszuschließen. Und ein Mittel dafür sind die Dinge, die uns ein sorgloses oder abgelenktes oder mit Glückshormonen gesättigtes Leben ermöglichen. Aber das verbirgt die Wirklichkeit, wie sie eigentlich ist.
KNA: Wie ist denn die Wirklichkeit?
Weber: Sie ist eine dauernde Verwandlung, ein ständiges Neuarrangieren des Vergänglichen. Wir existieren für eine vorübergehende Zeit als Individuen und lösen uns dann wieder in dem großen Ganzen auf, das immer wieder neue Individuen hervorbringt. Man kann sich dieser dauernden Verwandlung in der Natur, zu der auch wir gehören, nicht entziehen.
Man kann sich nur betrügen oder betäuben und versuchen, diese Tatsache zu ignorieren. Und das hat in den letzten 200 Jahren oder auch länger mit den Mitteln des wirtschaftlichen Wachstums funktioniert. Wir schaffen es, so viele Produkte für unsere vermeintliche Glückseligkeit herzustellen, dass wir uns nicht mehr mit der Gesetzmäßigkeit der ständigen Verwandlung und des immer wieder neuen Entstehens und neuen Vergehens auseinandersetzen müssen.
KNA: Glauben Sie, dass Corona die Haltung der Menschen zum Tod verändert hat, weil das Thema näher gerückt ist?
Weber: Das wäre wünschenswert. Zu Beginn der Pandemie meinten viele, Corona würde die Menschen zum Nachdenken bringen und wachrütteln. Im Moment sehe ich das noch nicht. Wir versuchen eher, die Luft anzuhalten und da durchzukommen. Es bestehen ja auch gewisse Chancen, dass wir halbwegs funktionierende Impfstoffe finden.
Ich habe eher das Gefühl, dass die Menschen versuchen, die Augen zu verschließen und eben nicht zu sagen: Stopp mit der Ablenkung, jetzt versuche ich, mehr im Moment zu leben. Oder ich versuche dieses radikal Offene, Unbestimmte in meinem Lebensfluss anzunehmen und dadurch auch in mir das anzunehmen, was nicht der Optimierung unterliegt.
KNA: Warum tun wir Menschen uns überhaupt so schwer damit, das Lebensgesetz von Leben und Tod, das eigentliches jedes Kind kennt, zu akzeptieren?
Weber: Das ist wohl die Schlüsselfrage an unsere Zivilisation. Natürlich sind der Tod und das Sterben kein Vergnügen; jedes Individuum versucht, den Tod zu vermeiden. Denn er ist eine echte Zumutung. Für frühere Kulturen war die Erkenntnis aber selbstverständlich, dass der Tod zum Leben dringend notwendig ist, damit neues Leben nachwachsen kann.
Wir können den Tod nicht abschaffen, wenn wir nicht auch das Leben abschaffen wollen. Stattdessen müssen wir lernen, mit dem Schmerz umzugehen und das Schmerzliche zu verstehen. Unsere Kultur hat aber in den vergangenen Jahrhunderten versucht, das Schmerzliche abzuschaffen oder unter den Teppich zu kehren.
KNA: Wie erklären Sie sich dieses Ausweichmanöver?
Weber: Ich knoble auch an dieser Frage und hätte gerne eine gute Hypothese, wann und warum sich die menschliche Kultur im Abendland entschlossen hat, dieses Lebensgesetz zu ignorieren.
Wenn wir uns aber verzweifelt an diese eine Existenz klammern, dann tendieren wir dazu, andere über die Klinge springen zu lassen; wir werden mitleidlos, schicken andere ins Verderben. Das kann man in unserer Zivilisation sehr gut erkennen: einerseits im Zwischenmenschlichen und in den furchtbaren Rassismen, aber natürlich auch im Umgang der Menschen mit den nichtmenschlichen Lebewesen.
KNA: Was wäre die Alternative?
Weber: Wenn wir akzeptieren, dass wir mit allem Leben die Erfahrung des Lebens und Sterbens teilen, dann könnte uns das mit allen verbinden. Es würde eine fundamentale Solidarität mit allen Formen des Lebens entstehen. Der Buddhismus spricht von der Erfahrung des bodenlosen Mitleids: Alle Lebewesen sind in dieser Lebenssituation, die einmal in eine Sterbesituation mündet. Diesbezüglich sind wir alle gleich, keiner ist dem anderen überlegen.
KNA: Das heißt, auch das Christentum mit seiner Auferstehungshoffnung hat den Menschen die Angst vor dem Tod nicht nehmen können?
Weber: Damit hat das Christentum leider die Hoffnung geweckt, dass wir uns durch das richtige Verhalten gegen den Tod immunisieren können. Und dass wir das ewige Leben nicht im Miteinander aller Wesen finden können.
KNA: Im indigenen Denken, über das Sie ein Essay geschrieben haben, gibt es ein ganz anderes Verständnis von Leben und Tod...
Weber: Für indigene, animistische Kulturen ist der Tod kein absoluter Abschluss wie für uns, sondern ein Übergangsstadium. Der Tod ist das Ende einer bestimmten Existenz, des Körpers, in dem wir hier sitzen, aber es ist der Beginn einer anderen Existenz - eventuell in einem anderen Körper oder im Reich der Geister und Ahnen, also im Gesamtkörper der Lebewesen eingewoben. Deshalb ist der Tod für sie nicht das absolute Schrecknis wie bei uns. Der Tod ist nur eine Station auf der Lebensreise, nicht der Prellbock am Endbahnhof.
KNA: Animistisches Denken gilt ja als überholt, Sie zeigen aber auf, dass es auch angesichts unserer ökologischen Krise zu einem umfassenderen Verständnis der Welt und deren Überleben beitragen kann.
Weber: Ich halte den Animismus überhaupt nicht für überholt, sondern vielmehr für eine mögliche Zukunftsperspektive. Überholt wirkt Animismus, wenn man ihn wie die frühindustriellen und christlich geprägten Gesellschaften als einen Aberglauben missversteht. Für Animisten leben wir nicht in einer Welt voller Dinge, sondern voller Personen. Alle haben Wünsche, Interessen und können mit uns kommunizieren.
Und im Augenblick greifen ganz aktuelle, auch wissenschaftliche Diskussionen viele Positionen dieses animistischen Denkens wieder auf. Dazu zählt die Idee, dass wir die Erde nicht nur als neutrales Klimasystem, sondern als Akteur wahrnehmen können. Was als philosophische und wissenschaftliche Revolution daherzukommen scheint, haben schon Völker vor 200.000 Jahren ähnlich gedacht.
KNA: Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
Weber: Die innere Haltung ändert sich dann: Wenn die Welt nicht aus unbeseelten Dingen besteht, die man grenzenlos und unbedarft konsumieren kann, sondern aus Personen, mit denen man sich ins gute Benehmen setzen muss, dann ist man ständig aufgefordert, in Beziehung zu treten und respektvoll zu sein. Man kann dann nicht einfach machen, was man will und eine goldenen Mauer um sich und die Mitwelt bauen.