DOMRADIO.DE: Wie sieht denn Ihre Projektarbeit in den verschiedenen Anrainerstaaten des Amazonas konkret aus?

Claudio Moser (Leiter des Referats Lateinamerika bei Caritas International): Unser Hauptanliegen ist der Schutz der Bevölkerung vor Ort. Es gibt sehr viele indigene Völker im Amazonasgebiet, aber auch andere traditionell wirtschaftende Gemeinschaften wie die Nachfahren afrikanischer Sklaven. Die sind stark von der voranschreitenden Zerstörung bedroht. Mit den Wäldern geht ja auch ihre Heimat verloren - alles, was sie brauchen, um zu überleben.

Zugleich sind sie durch ihre Kulturweise diejenigen, die den Wald am besten schützen. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen und auch unbestreitbare Aufnahmen, die zeigen, dass die Schutzgebiete der indigenen Völker oder der Nachfahren der afrikanischen Sklaven stehengeblieben sind und der Zerstörung getrotzt haben.
DOMRADIO.DE: Man hört immer wieder, dass der Amazonas ein so unübersichtliches Gebiet ist, dass sich selbst die Behörden vor Ort nicht mehr auskennen. Wie treten Sie mit den Völkern in Kontakt?
Moser: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt tatsächlich noch unkontaktierte Völker, die bewusst den Kontakt mit der Mehrheitsgesellschaft nicht wollen, weil sie wissen, dass ein Kontakt dazu führen kann, dass Krankheiten eingeschleppt werden, die ihre Gemeinschaften dezimieren.
Und es gibt Völker, die durchaus schon mit Handy gut erreichbar und auch in der Lage sind, mit den Instrumenten, die die heutige Technologie bietet, zu kommunizieren. Es ist sehr unterschiedlich.
Wir arbeiten natürlich nicht mit denen, die unkontaktiert bleiben wollen, sondern mit Gemeinschaften, die schon an Kommunikationsmöglichkeiten Anschluss haben. Da läuft es relativ gut, wenn die Verbindung steht.
DOMRADIO.DE: Wie unterstützen Sie sie?

Moser: Wir bringen nur in den seltensten Fällen Nahrung. Die Bildungsarbeit ist tatsächlich schon auf einem höheren Niveau angesiedelt. Es geht eher um politische Bildung, denn die Ursachen für die Zerstörung ihres Landes liegen oft in Großprojekten wie Staudämmen, Straßenbau, Eisenbahnlinien oder Bergbau, die die ganze Erde aufreißen.
Dagegen müssen sich die indigenen Völker wehren können. Dafür müssen sie sich organisieren, sich aufstellen, schauen, wie sie sich mit anderen verbinden. Sie müssen auch ihre Rechte kennen, um effektiver gegen die Eindringlinge vorzugehen. Die Hauptarbeit besteht darin, die Gemeinschaften zu stärken, sich selber verteidigen zu können.
DOMRADIO.DE: Es gibt in den unterschiedlichen Ländern im Amazonasgebiet sehr unterschiedliche politische Situationen. Macht es für Sie einen Unterschied, ob Sie in Brasilien oder in Kolumbien aktiv sind?

Moser: Es macht einen großen Unterschied. Nun sind gerade Brasilien und Kolumbien politisch betrachtet in der jetzigen Phase relativ nah beieinander. Aber die Rahmenbedingungen sind komplett andere. Kolumbien ist noch viel stärker durch die Drogenproblematik geprägt. Der Drogenanbau in Amazonien ist massiv vorangeschritten und es gibt sehr gewalttätige Gruppen.
In Brasilien sind es eher die Goldgräber, die die meisten Probleme verursachen, weil sie die Flüsse mit Quecksilber verschmutzen. Schlimme Krankheiten breiten sich deswegen aus.
Die Yanomami als ein bekanntes brasilianisches Volk haben unter der Bolsonaro-Regierung besonders viel gelitten, weil ihnen in der Zeit überhaupt nicht geholfen worden ist.
Das sind also unterschiedliche Gründe. Wir haben dann wiederum in Peru andere Situationen. Oder in Ecuador.
In Ecuador haben wir zum Beispiel das Problem mit dem Erdöl. Da wird Erdöl gefördert. Das sind keine kleinen illegalen Gruppen, sondern Unternehmen, die dort operieren und das Land der Indigenen regelrecht mit dem Erdöl vergiften, das da zum Teil aus den Pipelines fließt, wenn die bersten.
Im Hintergrund steht meistens aber ein Absatzmarkt, wohin diese Produkte verkauft werden. In letzter Linie sind die Konsumenten, die billige Produkte kaufen – sei es Rindfleisch, Soja, Aluminium, Kupfer, Gold, was auch immer – diejenigen, die die Zerstörung in Amazonien mit verursachen.
DOMRADIO.DE: Auch die Kirche engagiert sich beim Schutz des Amazonasgebiets. Papst Franziskus legt immer wieder den Finger in die Wunde. Wir haben "Laudato si" als Umweltenzyklika, wir hatten 2019 die Amazonassynode. Spielt das vor Ort überhaupt eine Rolle, wenn die Kirche sich zu diesem Thema äußert?
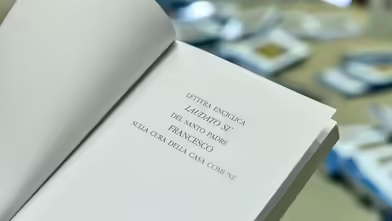
Moser: Die Enzyklika des Papstes ist ja als Umweltenzyklika bekannt. Der Papst hat selber sehr oft und sehr deutlich darauf hingewiesen, dass er soziale Probleme und ökologische Probleme als Einheit betrachten möchte. Es sind zwei Seiten einer Medaille, und die kann man gar nicht trennen. Die Enzyklika ist ja nicht vom Himmel gefallen, die ist aus einer gewissen Arbeit der lateinamerikanischen Kirche der letzten Jahrzehnte entstanden.
Die lateinamerikanische Kirche hat sich seit Jahrzehnten in Teilen – eher die sozial orientierten Teile, nicht die konservativen – um die Rechte der ausgeschlossenen Bevölkerungsgruppen bemüht und Rechte gestärkt. Dabei wurde immer deutlicher, dass diese Rechte eben nicht nur wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Natur sind, sondern auch ökologischer Natur. Das ist dann eine Einheit.
Die in der Kirche sozial-pastoral Engagierten oder auch die Caritas-Organisationen, existierten schon vor der Enzyklika, haben sich durch die Enzyklika bestärkt gefühlt und arbeiten jetzt weiter in der Richtung, das soziale und ökologische Engagement der Gemeinschaften zu verbessern und zu stärken.
DOMRADIO.DE: Die Konferenz der Amazonas Anrainerstaaten will das ganze Thema auf politischer Ebene angehen. Denken Sie, dass bei diesem Treffen etwas rumkommen könnte, dass in der Situation etwas ändert? Oder ist das eher ein politisches Symbol?

Moser: Ich denke, es ist mehr ein Symbol. Es ist ein wichtiger Schritt. Die Politik braucht einen Wandel. Es muss sich etwas ändern in dieser Zerstörungswut. Die bringt den Ländern ja auch nur noch für wenige Jahre etwas. Danach ist Schluss mit der Ausbeutung von den Naturressourcen und dann werden die Länder massive Probleme haben – nicht nur mit dem globalen Klimawandel, der dadurch verstärkt wird, sondern allein schon mit den Regenzyklen.
Selbst die Industrie, die auf Agrarprodukte setzt, wird in den Ländern darunter leiden, wenn auf einmal die Regenfälle ausbleiben oder viel unregelmäßiger kommen. Es ist ökonomisch extrem notwendig, jetzt eine Wende herbeizuführen.
Das Problem ist diese Kurzsichtigkeit von vielen politischen Entscheidungen und die Abhängigkeit von starken Wirtschaftsinteressen, denen die Regierungen selber auch unterliegen. Da spielt auch das Ausland wieder eine Rolle. Wenn man immer nur auf Senkung von ökologischen und sozialen Standards setzt, um die Produkte billiger einzukaufen, dann ist auch der importierende Markt aus Europa, USA, Japan, China mit dafür verantwortlich, dass dort diese Zerstörung passiert.
Es ist also wichtig, dass die Länder ein Signal setzen, dass sie jetzt mehr für den Schutz des Regenwaldes tun wollen. Aber wie die Umweltministerin von Brasilien, Marina Silva, selber sagt: Es geht nicht nur, wenn wir hier was machen, es muss schon weltweit eine Wende eintreten.
Das Interview führte Renardo Schlegelmilch.









