Am 06.03.2008 haben wir uns mit Ihnen über Fragen der gesetzlichen Regelung von Patientenverfügungen ausgetauscht. Bei dieser Gelegenheit haben Sie uns gebeten, Ihnen den Standpunkt der Kirchen noch einmal schriftlich vorzutragen. Wir sind Ihnen und Ihren Kollegen dankbar, dass Sie die Position der Kirchen und ihrer Wohlfahrtsverbände wie bereits im bisherigen Verlauf der Diskussion in Ihre Überlegungen einbeziehen. Ihrer Bitte kommen wir gerne nach.
Wir konzentrieren uns dabei auf den von den Abgeordneten Joachim Stünker u.a. initiierten Gesetzentwurf, der bisher als einziger formell in das parlamentarische Verfahren eingebracht worden ist und den Abgeordneten des Bundestages unter dem Datum des 06. 03. 2008 als Drucksache 16/8442 vorliegt. Im Fortgang der Beratungen werden möglicherweise weitere Gesetzentwürfe hinzukommen. Wir behalten uns vor, die im Folgenden vorgetragenen Gesichtspunkte im Blick auf andere Gesetzentwürfe gegebenenfalls zu ergänzen und zu konkretisieren.
Der vorliegende Gesetzentwurf vom 06. 03. verfolgt im wesentlichen drei Ziele:
§ den Menschen die Gewissheit zu geben, dass sie über die Art und Weise ihrer medizinischen Behandlung auch dann selbst bestimmen können, wenn sie ihre Entscheidungsfähigkeit verloren haben,
§ das im Grundgesetz verankerte Selbstbestimmungsrecht jedes Menschen zu achten und zu verwirklichen
§ und für alle Beteiligten mehr Rechtssicherheit zu schaffen.
So sehr diese drei Ziele Respekt und grundsätzliche Zustimmung verdienen - die von uns geltend gemachten Vorbehalte beziehen sich auch auf die Einseitigkeit, mit der das Selbstbestimmungsrecht zum Ankerpunkt der gesamten Argumentation gemacht wird, und auf die problematischen Folgen, die dadurch hervorgerufen werden:
1. In der Ausübung seines Selbstbestimmungsrechtes ist der Mensch darauf angewiesen, dass andere Menschen sich seiner annehmen; das gilt gerade in Zeiten der Krankheit und Hinfälligkeit. Selbstbestimmung des Patienten und Fürsorge für ihn sind miteinander zu verbinden und aufeinander zu beziehen. Es ist ein Ausdruck recht verstandener Selbstbestimmung und gebotener Fürsorge, Wünsche und Entscheidungen einer Patientenverfügung nicht einfach als das letzte Wort eines Patienten zu nehmen. Dies wird besonders deutlich, wenn sie erkennbar in Unkenntnis der Möglichkeiten medizinischer Behandlung oder späterer medizinischer Entwicklungen abgegeben wurde und Anhaltspunkte dafür namhaft gemacht werden können, dass der Betroffene bei deren Kenntnis eine andere Entscheidung getroffen hätte.
2. Der Gesetzentwurf weist mit § 1901a BGB-E dem Betreuer für den Fall, dass eine Patientenverfügung vorliegt, die Aufgabe zu, zu prüfen, ob die in der Patientenverfügung getroffenen "Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zutreffen" - um daran folgende Regelung anzuschließen: "Ist dies der Fall, so hat der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen." Mit dieser Rollenbeschreibung wird die Verantwortung, die von einem Betreuer und von einem Bevollmächtigten (vgl. § 1901a Abs. 4 BGB-E) bei der Auslegung der Patientenverfügung und ihrer Anwendung wahrzunehmen ist, nicht ausreichend gewichtet.
Die Kirchen treten für die Stärkung des Instituts der Vorsorgevollmacht ein. Betreuer und Bevollmächtigtem obliegt es, zu prüfen, ob der in der Patientenverfügung beschriebene Sachverhalt vorliegt und ob es Anzeichen dafür gibt, dass der aktuelle Patientenwille sich von dem in der Verfügung formulierten unterscheidet. Der Entscheidung des Betreuers oder Bevollmächtigten sollte immer das Gespräch mit Angehörigen, Ärzten und Pflegenden vorausgehen. In Ausnahmefällen, in denen kein Vertreter vorhanden ist und weder die Bestellung eines Betreuers noch die Einwilligung durch das Vormundschaftsgericht abgewartet werden können, muss der Arzt auf der Grundlage der Patientenverfügung über die Einleitung bzw. Fortführung einer Behandlung entscheiden.
3. Es ist unstrittig, dass der in einer Patientenverfügung im Voraus und schriftlich niedergelegte Wille nicht notwendigerweise mit dem aktuellen Willen übereinstimmt. Entscheidend ist, den einen Fall vom anderen unterscheiden zu können. Die Verfasser des Gesetzentwurfs bemühen sich in dem Begründungsteil zwar erkennbar darum, auf dieses Problem hinzuweisen und Lösungsschritte aufzuzeigen (vgl. etwa A.2 im Begründungsteil). Ein "Dialog zwischen den an der Behandlung Beteiligten" sei "erforderlich, in dem über die Vornahme ärztlicher Maßnahmen entschieden wird". Aber damit ist es nur schwer zu vereinbaren, dass eine klare und einseitige Tendenz vorgegeben wird: Dieser Prozess habe "soweit wie möglich die Durchsetzung des zu einem früheren Zeitpunkt geäußerten Patientenwillens zu sichern".
4. Damit verbindet sich ein generelles Problem: Der Begründungsteil enthält an vielen Stellen differenzierte Töne und zeigt so Sensibilität für die Schwierigkeit der zu treffenden Abwägungen. Im vorliegenden Gesetzentwurf sind aber die Gewichte zwischen der Behutsamkeit im Begründungsteil auf der einen und den ohne Wenn und Aber formulierten Rechtssätzen auf der anderen Seite zuungunsten eines behutsamen Vorgehens verschoben. Die Rechtssätze werden am Ende für den Umgang mit Patientenverfügungen die Messlatte bilden, den anderen Gesichtspunkten fehlt die Dauerhaftigkeit und institutionelle Festigkeit.
5. Besonders heikel ist die Frage der Reichweite von Patientenverfügungen. Ein in jeder Hinsicht überzeugender Regelungsvorschlag liegt bisher nicht vor. In keinem Fall ist es akzeptabel, wenn die in einer Patientenverfügung getroffenen Festlegungen "unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung des Betreuten (gelten)" sollen. Dies hätte schwerwiegende Konsequenzen, wie man sich exemplarisch an der Gruppe der Wachkomapatienten und der dementiell Erkrankten klar machen kann.
Die Kirchen haben mit der "Christlichen Patientenverfügung", die seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 1999 an über 2,9 Millionen Menschen abgegeben wurde, viel dafür getan, das Instrument der Patientenverfügung bekannt zu machen und zu stärken. Auch daher rührt das besondere Interesse der Kirchen an dem Gesetzgebungsverfahren.
Im Übrigen liegt uns daran, dass die Debatte über Patientenverfügungen nicht losgelöst geführt wird von der Sorge um eine würdevolle und angemessene Sterbebegleitung. Letztendlich geht es darum, den Bedürfnissen sterbender Menschen möglichst umfassend gerecht zu werden, damit jeder Einzelne frei von Schmerzen, Angst und Unruhe seinen persönlichen Tod sterben kann. Dazu leisten Patientenverfügungen einen wichtigen Beitrag. Menschenwürdige Sterbebegleitung muss aber insbesondere palliativmedizinische Versorgung, fürsorgende Betreuung und seelsorgerliche Begleitung bis zum Ende des Lebens beinhalten. Deshalb bleiben die Verbesserung der palliativmedizinischen Versorgung und der Ausbau des Hospizwesens dringend notwendig.
Wir bitten sie herzlich darum, unsere Überlegungen bei der weiteren Beratung einer gesetzlichen Regelung des Umgangs mit Patientenverfügungen zu berücksichtigen.
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Dr. Robert Zollitsch
Der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Dr. Wolfgang Huber
Schreiben der Kirchen-Vorsitzenden zur gesetzlichen Regelung des Umgangs mit Patientenverfügungen
Im Wortlaut
domradio.de dokumentiert das Schreiben vom 14. Mai 2008 des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Dr. Robert Zollitsch und des Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bischof Dr. Wolfgang Huber an die Bundestagsabgeordneten zum Thema Patientenverfügung.
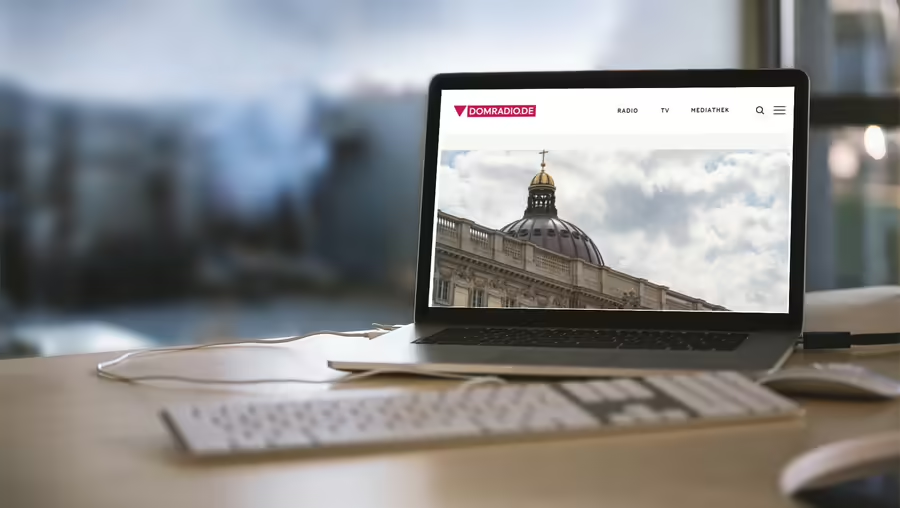
Share on