Tritt in den USA ein schwarzer Politiker gegen einen weißen an, sind Erhebungen erfahrungsgemäß nicht so verlässlich wie bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei weißen Kandidaten: Manche der weißen Befragten versichern, sie seien für den Afro-Amerikaner oder unentschlossen - stimmen in der Wahlkabine dann aber doch für den Hellhäutigen.
Das Phänomen hat einen Namen: «Bradley Effekt», in Anlehnung an den Afro-Amerikaner Tom Bradley, der 1982 in Kalifornien die Gouverneurswahl verlor, nachdem er kurz zuvor einen zweistelligen Vorsprung hatte. «Dieses Wählerverhalten ist nicht einfach zu erklären», sagt Carmen Van Kerckhove, die mit ihrer Beratungsfirma «New Demographic» Firmen, Universitäten und Behörden hilft, Vorurteile abzubauen. Man könne nicht einmal behaupten, dass diese Wähler lügen, sie hätte aber «unbewusste Vorurteile».
Die Wahlforscher sind unterschiedlicher Ansicht über die genauen Auswirkungen des «Bradley Effekts» bei der Wahl am 4. November. David Bositis, Wahlexperte beim «Joint Center for Political and Economic Studies», vertritt die Auffassung, «Bradley» sei eher ein Problem der Vergangenheit. Jö Trippi dagegen, Berater der Demokraten und 1982 Bradleys Wahlmanager, sagte dem Informationsdienst politico.com, er würde sich wegen des Effekts Sorgen machen, sollte Obama kurz vor der Wahl nur einen Vorsprung von einem Punkt oder zwei Punkten haben.
Rassenvorurteile bestimmen immer noch Wahlverhalten
Und der texanische Soziologieprofessor Jö Feagin meint: «Gut angelegte Umfragen liefern verlässliche Resultate - aber nur, wenn beide Kandidaten weiß sind.» Die bislang laut Umfragen «unentschlossenen» hellhäutigen Wähler würden letztlich mehrheitlich für McCain stimmen, sagt er dem epd. Bei der Erhebung am Telefon wollten viele Befragte gegenüber dem Interviewer «gut dastehen» und jeden Eindruck von Rassismus vermeiden - vor allem, wenn sie nicht wüssten, welche Hautfarbe der Anrufer hat.
Auf abweichendes Antwortverhalten weisen auch Straßenumfragen hin, bei denen die Wähler sahen, wer ihnen die Fragen stellte: War der Interviewer ein Schwarzer, fielen die Zustimmungswerte für Obama unter Weißen regelmäßig höher aus.
Rassenvorurteile seien tief verwurzelt in den USA, einer Nation, die 246 Jahre Sklaverei hinter sich habe und erst vor 40 Jahren mit den Bürgerrechtsgesetzen ein Apartheid-System abgeschafft habe, betont Feagin. Seine Untersuchungen zeigten zwar, dass sich Rassismus verändert habe. Die meisten Weißen hätten gelernt, dass rassistische Reden und Taten in der Öffentlichkeit nicht länger akzeptiert werden.
Denkmuster hätten sich aber nicht grundsätzlich verändert. Zehn bis 20 Prozent der Weißen würden wohl nie für einen afro-amerikanischen Präsidentschaftskandidaten stimmen.
Tatsächlich bekommt Barack Obama in den neuesten Umfragen unter Weißen keine Mehrheit. Nach einer Gallup-Umfrage würden 50 Prozent der Weißen McCain wählen, dagegen nur 42 Prozent Obama. Anders bei den Nicht-Weißen: 64 Prozent der Latinos und 89 Prozent der Afro-Amerikaner, die zusammen rund 30 Prozent der Bevölkerung ausmachen, wollen demnach für Obama stimmen.
Von Kerckhove gibt Obama relativ gute Gewinnchancen. Die Finanzkrise verdränge das Rassismusproblem, ist er überzeugt. Feagin dagegen erwartet in den kommenden Wochen eine Schlammschlacht. Viele europäischstämmige US-Amerikaner akzeptierten Obama, weil er als «Ausnahme» unter den Schwarzen gelte. Deshalb würden die Republikaner Obama jetzt als «typischen Schwarzen» darstellen wollen, dem man nicht trauen könne.
Spekulationen um fehlerhafte Umfragen in den USA
Wie ehrlich ist der weiße Wähler?
Meinungsumfragen zu den Präsidentschaftswahlen in den USA deuten alle in dieselbe Richtung: Der Demokrat Barack Obama liegt deutlich vor John McCain, dem Republikaner. Manche Erhebungen ergeben vier oder fünf Prozentpunkte Unterschied, andere mehr. Diesen Zahlen verbergen allerdings eine viel komplexere Realität. Machen die weißen Wähler, wenn es darauf ankommt, wirklich ihr Häkchen bei Obama?
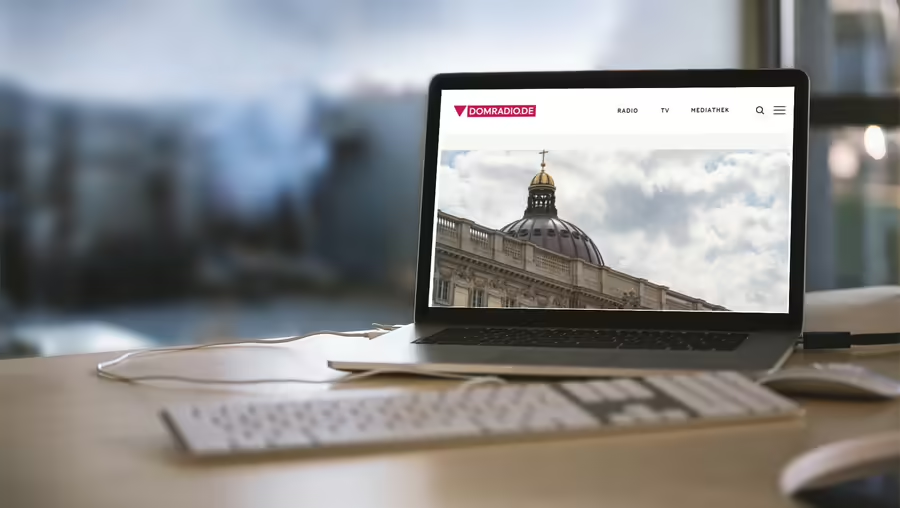
Share on