Mexikos konservativer Präsident Felipe Calderón verband seine Glückwunsche an Obama mit dem Wunsch auf "freie und respektvolle" Gespräche sowie "gegenseitiges Vertrauen". Denn Lateinamerika fühlte sich in den acht Jahren Amtszeit von Präsident George W. Bush von den USA schlicht vergessen. Wenn die südlichen Nachbarn überhaupt in der US-Öffentlichkeit behandelt wurden, dann unter dem Thema illegale Einwanderung. Der noch unter Bush beschlossene, aber bisher nicht realisierte Plan für einen tausend Kilometer langen Grenzwall zu Mexiko symbolisiert in den Augen vieler die abschätzige Haltung der USA gegenüber Lateinamerika.
Der Politikprofessor Jorge Mayer in Buenos Aires erwartet, dass sich unter dem ersten schwarzen Präsidenten in Washington vor allem die Lage der zwölf Millionen illegaler Einwanderer aus Lateinamerika verbessern wird. "Man kann davon ausgehen, dass Obama mehr Gespür für den Umgang mit Minderheiten hat", sagte er. Obama selbst hatte im Wahlkampf versprochen, nach Wegen für eine Legalisierung der Immigranten zu suchen.
Unterstützung aus Kuba
Die größte Unterstützung für Obama kam in Lateinamerika aus Kuba. Am Wahltag ließ der erkrankte Revolutionsführer und frühere Präsident Fidel Castro verlauten, Obama sei "intelligenter, gebildeter und gerechter als sein republikanischer Gegner". Die Stimmempfehlung des Kommunisten Castro - das schlimmste, was einem US-Politiker widerfahren kann - versuchte der Republikaner John McCain sofort zu seinen Gunsten zu nutzen. Wenige Stunden nach der Publikation von Castros Artikel in Kubas Staatsmedien liefen 90 Meilen weiter nördlich in Miami die Telefone heiß. Automatische Anrufdienste warnten die Wähler: "Gib Castro nicht, was er will". Doch auch die letzte verzweifelte Werbeaktion half McCain nicht mehr: Auch der Bundesstaat Florida, die Hochburg der Exilkubaner, ging an Obama.
Auch Kubas Dissidenten begrüßten Obamas Sieg und äußerten die Hoffnung auf ein Ende der Eiszeit zwischen Havanna und Washington.
Der Ökonom Oscar Espinosa sagte: "Die bisherige konfrontative Politik der USA diente Kubas Regierung nur als Vorwand, die Repression zu rechtfertigen." Sollten sich die USA unter dem neuen Präsidenten dialogbereit zeigen, werde dies den gewünschten Wandel in Kuba fördern.
Auch von Kubas Bündnispartner Venezuela kam Zuspruch. Staatschef Hugo Chávez nannte Obama ein "kleines Licht am Horizont". Erst im September hatte der Linkspopulist Chávez den US-Botschafter ausweisen lassen. Am Dienstag kündigte Chávez an, mit Obama Gespräche über eine Verbesserung der Beziehungen führen zu wollen. Zugleich forderte er die Schließung des umstrittenen US-Gefangenenlagers in Guantánamo auf Kuba. Auch weiter südlich hofft man auf eine Wende in Washington.
Argentiniens Präsidentin Cristina Kirchner hat laut Medienberichten Obama die Daumen gedrückt.
"Das Ende der Flitterwochen?" in Kolumbien
Wenig euphorisch fiel die Reaktion lediglich in Kolumbien aus, dem bisher treuesten Partner der USA in Lateinamerika. "Das Ende der Flitterwochen?", fragt die Zeitung "El Espectador" nach Obamas Wahlsieg. Kolumbiens konservativer Präsident Álvaro Uribe erhielt in den vergangenen Jahren milliardenschwere Militärhilfe aus den USA zur Bekämpfung der FARC-Guerilla und des Koka-Anbaus. Diese Mittel könnten von dem neuen demokratischen Präsidenten in Washington genauso kritisch geprüft werden wie ein Freihandelsabkommen, das kurz vor der Ratifizierung steht. Obama könnte auch Uribes Vorhaben bremsen, sich über eine Verfassungsänderung eine dritte Amtszeit zu sichern.
Ob Obama Lateinamerika wirklich wichtiger nehmen wird, bezweifelt die mexikanische Wissenschaftlerin Laura del Alizal. Der unterlegene McCain wisse mehr über die südlichen Nachbarn und habe im Wahlkampf Mexiko und Kolumbien besucht, sagte sie. Obama blamierte sich hingegen mit seinen speziell an Latinowähler in den USA gerichteten Spots. Allzu offensichtlich spricht er nur rudimentär Spanisch.
Lateinamerika fühlte sich von US-Präsident Bush vergessen
Obama weckt Hoffnung auf Brüderlichkeit
Als sich Barack Obamas Wahlsieg in den USA abzeichnete, sprach in Lateinamerika als erster Präsident Fernando Lugo von Paraguay. Der neue US-Präsident sollte seine südlichen Nachbarn respektieren und "brüderliche Beziehungen mit Lateinamerika" anstreben, sagte er. Damit brachte er die Wünsche zum Ausdruck, die linke wie rechte Staatspolitiker, große wie kleine Länder, in Lateinamerika an den neuen US-Präsidenten knüpfen: Sie hoffen auf mehr Aufmerksamkeit und einen Dialog auf Augenhöhe.
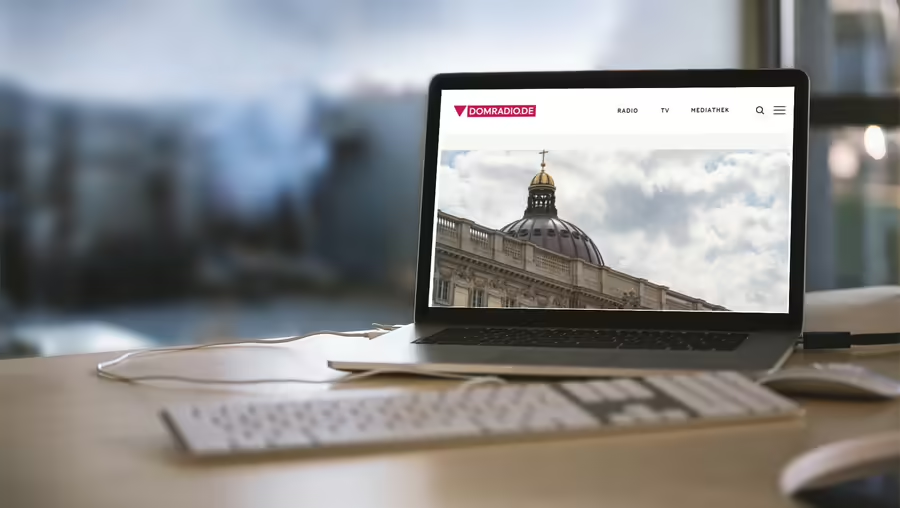
Share on