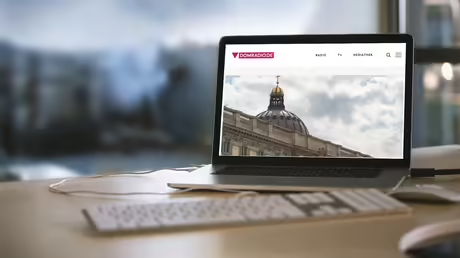KNA: Frau Habesch, wie ist die aktuelle Situation im Gazastreifen?
Habesch: Sie ist desolat. Die Menschen bekommen zwar Hilfsgüter wie Lebensmittel, Kleidung, Medizin - aber sehr unregelmäßig und oft mit langen Wartezeiten. Es ist immer nur genug für den jeweiligen Augenblick. Sollten die Lieferungen aus irgendeinem Grund wieder gestoppt werden, bräche sofort Notstand aus. Gleichzeitig weigern sich Israel und Ägypten, Baumaterial in das Krisengebiet zu lassen. Die israelische Offensive hat dort rund 4.000 Häuser komplett und 17.000 teilweise zerstört.
Viele der Bewohner sind zwar bei Verwandten oder Freunden untergeschlüpft, aber natürlich unter extrem beengten Verhältnissen.
Etwa 500 Familien campieren nach wie vor in Notzelten. Bei den niedrigen Temperaturen der vergangenen Wochen und dem vielen Regen kann man sich vorstellen, was das bedeutet. Am belastendsten ist aber für viele die Unsicherheit: Wie geht es weiter? Niemand weiß das. Und dann gibt es immer wieder israelische Luftangriffe, die die Angst wach halten. Auch die Raketenangriffe der Milizen aus dem Gazastreifen sind ja durch die israelische Offensive keineswegs gestoppt worden - trotz der vielen Todesopfer und Verletzten.
KNA: Das heißt, Ihre erste Forderung als Caritas Jerusalem ist die Öffnung der Grenzen für mehr Hilfe?
Habesch: Als Hilfsorganisationen fordern wir natürlich zunächst die Ermöglichung einer effektiven humanitären Hilfe. Wir haben ja weiterhin große Probleme, unsere Mitarbeiter in den Gazastreifen zu bekommen. Und das geht nicht nur uns so: Das Lateinische Patriarchat von Jerusalem etwa bemüht sich seit einem Monat vergeblich, Durchgangs-Genehmigungen für fünf ausländische Priester zu erhalten, die den Pfarrer von Gaza-Stadt unterstützen wollen. Israel lässt sie bis jetzt nicht rein. Aber unsere Hauptforderung ist eine politische Lösung. Die Menschen in Gaza brauchen eine echte Perspektive. Was nützt es, für viele Milliarden Dollar die zerstörten Häuser wieder aufzubauen, wenn in einem Jahr wieder alles kaputt ist? Und wie soll es zu einem Ende der Gewalt kommen, wenn die Menschen in einem Gefängnis sitzen und keine Zukunft haben? Verhandelt wurde schon viel - jetzt ist es Zeit, zu handeln.
KNA: Wie versucht Caritas Jerusalem, im Gazastreifen zu helfen?
Habesch: Zum einen haben wir 3.700 Hilfspakete mit Alltagsgütern
gepackt: Zahnpasta, Shampoo und so weiter. Die warten darauf, in den Gazastreifen gelassen zu werden. Zudem haben wir weiter unser medizinisches Personal vor Ort: in einem medizinischen Zentrum, fünf Notversorgungspunkten und einer mobilen Klinik. Das Team hat in der Zeit des Krieges Großartiges geleistet. Die Besatzung der mobilen Klinik hatte von mir nach Beginn der Luftoffensive klare Order, zu Hause zu bleiben. Andere Krankenwagen waren gezielt angegriffen worden, da konnte ich nicht das Leben unserer Leute riskieren.
Nach einigen Tagen rief mich einer der Ärzte an und sagte: "Ich weiß, dass wir nicht hätten losfahren dürfen. Aber wir konnten nicht anders." Sie waren zu den völlig überfüllten UN-Schulen gefahren, um den Menschen, die dort Zuflucht gesucht hatten, zu helfen - trotz der Gefahr für ihr eigenes Leben. Da war ich sehr stolz auf sie, obwohl sie sich meiner klaren Order widersetzt hatten. Übrigens war das in diesem Fall ein rein muslimisches Team, da der christliche Chefarzt der mobilen Klinik einen Monat vorher verstorben war. Bei der Caritas arbeiten die Menschen ohne Unterschied von Religion oder Geschlecht Hand in Hand.
KNA: Welche Projekte hat die Caritas noch im Gazastreifen?
Habesch: Wir versuchen vor allem, die Jugend zu erreichen. In Gaza ist ja mehr als die Hälfte der Bevölkerung minderjährig, und praktisch alle Kinder sind traumatisiert. Sie kennen kein Leben ohne Gewalt. Im "Shati"-Flüchtlingslager haben wir darum mit Spendengeldern ein psychosoziales Zentrum eingerichtet, wo die Kinder unbeschwert spielen und die Mütter sich Rat holen können.
Auffällige Kinder werden von einer Psychologin betreut. Im Gazastreifen herrscht eine Atmosphäre ohnmächtiger Wut. Viele Kinder sind aggressiv - was nicht verwundert. Im Grunde sind sie völlig verängstigt; viele haben Symptome schwerer Traumata wie Bettnässen und Konzentrationsschwäche.
Neben der alltäglichen Arbeit im Zentrum organisieren wir sogenannte Spaß-Tage, um die Kinder aus ihrem Schmerz und ihrer Wut herauszuholen. Viele von ihnen wissen kaum, was es heißt zu spielen.
Israel lässt ja auch keine Spielsachen in das Gebiet. Spielen ist aber wichtig für ihre Entwicklung. Und sie müssen lernen, sich nicht von ihrer Wut beherrschen zu lassen, sondern im Rahmen ihrer beschränkten Möglichkeiten konstruktiv an ihrer Zukunft zu bauen.
Das ist natürlich unter den gegebenen Umständen sehr schwer. Für die Kinder wie für alle Menschen im Gazastreifen gilt deshalb, dass sie vor allem Frieden und Gerechtigkeit brauchen, um sich normal entfalten zu können.
Caritas-Chefin über die Lage der Menschen im Gazastreifen
"Eingesperrt, verängstigt, voller Wut"
Zwei Monate nach dem Krieg im Gazastreifen klagen Hilfsorganisationen weiter über Hürden bei ihrer Arbeit für die schwer getroffene Zivilbevölkerung. Hilfslieferungen würden lange an den Grenzen des abgeriegelten Gebiets aufgehalten, sagt die Generalsekretärin von Caritas Jerusalem und palästinensische Christin Claudette Habesch im KNA-Interview. Für viele Güter gebe es gar keine Genehmigung.
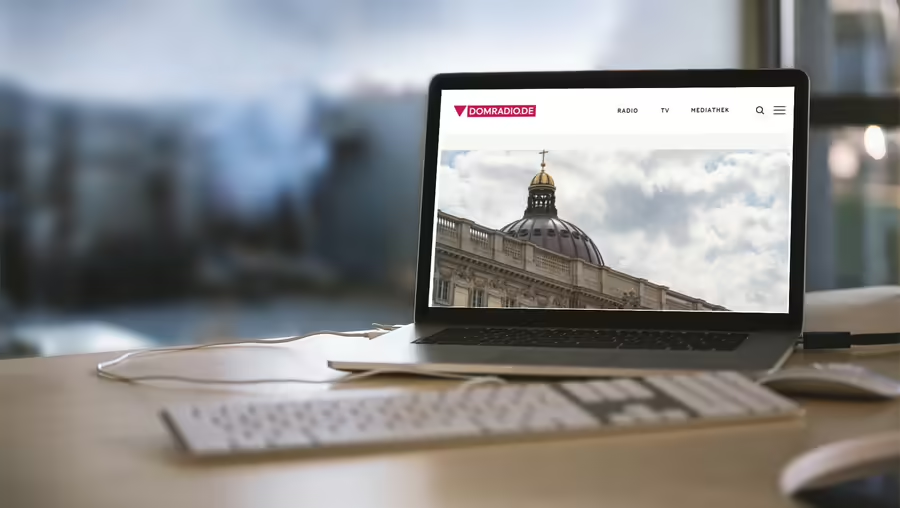
Share on