«Wir wollen Euer Partner sein, nicht Euer Wohltäter», betonte Hillary Clinton am Mittwoch in Nairobi. Von Kenia reiste die Ministerin weiter nach Südafrika und Angola, in die Demokratische Republik Kongo, und nach Nigeria und Liberia, bevor sie Ende nächster Woche von den Kapverden Richtung Heimat fliegt.
Clinton tritt in die Fußstapfen Obamas, der bei seiner Visite Anfang Juli in Ghana vor allem an die Eigenverantwortung der Bevölkerung und Regierungen appellierte. Die Afrikaner selbst müssten die Verantwortung für ihre Zukunft übernehmen. Nach Angaben des US-Außenministeriums will Clinton Unterstützung für demokratische Regierungen zum Ausdruck bringen, die Wirtschaftsentwicklung fördern und beim Schlichten von Konflikten helfen. Für zu viele Afrikaner sei Krieg ein Teil ihres Alltagsleben, das hatte schon Obama bedauert.
Der Krieg liege ihnen «wie ein Mühlstein um den Hals».
Taten müsssen erst noch folgen
Kritikern sind diese Worte nicht genug. Globalisierungsexperte David Rothkopf von der US-amerikanischen Carnegie-Stiftung klagt, dass die Regierung Obama zwar viel über die Bedeutung der Beziehungen zu Afrika rede, Taten aber erst noch folgen müssten. Symptomatisch sei, dass Obama noch keinen Direktor der US-Behörde für Entwicklungshilfe (USAID) gefunden habe. Es bestehe ein «schmerzhafter Kontrast» zwischen den Worten des Präsidenten und der Führungslosigkeit bei USAID, bemängelte auch die stellvertretende USAID-Chefin unter Präsident Bill Clinton, Carol Lancaster, in der «Washington Post».
Ein Bericht des «Brookings Institute», das der Demokratischen Partei nahesteht, betonte, die US-Regierung müsse sich allein schon aus Eigeninteresse stärker entwicklungspolitisch engagieren. Sonst verliere sie ihren Einfluss in diesem Bereich an Stiftungen und andere Industrieländer. In Afrika ist China als größter Konkurrent auf den Plan gerückt. In zahlreichen Nationen des Kontinents sei die Volksrepublik mittlerweile «größte Handelspartner und Geber», warnt der Washingtoner Think Tank.
Finanzmittel effektiver verteilen
Präsident Barack Obama steuert gegen. Er hat versprochen, die Entwicklungshilfe bis zum Jahr 2014 insgesamt zu verdoppeln. 2008 stellten die USA mit 26 Milliarden US-Dollar zwar im Vergleich mit anderen Industrienationen das meiste Geld bereit. Gemessen am Bruttonationaleinkommen betrugen die Ausgaben jedoch lediglich 0,18 Prozent.
Die Finanzmittel sollen künftig nicht nur aufgestockt, sondern auch effektiver eingesetzt werden. Clinton will dazu mehrere hundert Fachleute einstellen. Sie sollen dafür sorgen, dass USAID-Hilfsgelder direkt vor Ort ausgegeben werden und nicht erst über die Konten US-amerikanischer Beraterfirmen fließen. «Zu viel Entwicklungshilfe ist in den USA geblieben,» sagte Clinton in Nairobi, und «zu wenig hat die Zielbevölkerung erreicht». Demokratische und republikanische Senatoren stellten Ende Juli einen Gesetzesentwurf vor, der Abhilfe schaffen soll.
Auch in Fragen der nationalen Sicherheit soll der Entwicklungspolitik demnach ein größeres Gewicht zukommen. Wenig verwunderlich ist deshalb, dass zwei ölreiche Nationen auf Clintons Reiseplan stehen: Angola und Nigeria. Seit Ende der 90er Jahre hat Afrika als Erdöllieferant an Bedeutung zugenommen. Nach Angaben des Direktors des «African Security Research Project», Daniel Volman, liefern Nigeria, Angola und andere afrikanische Nationen den USA mittlerweile mehr Öl als der Nahe Osten.
Schon Obamas Amtsvorgänger George W. Bush hatte den Zugang zu afrikanischem Erdöl zur «nationalen Sicherheitsangelegenheit» erklärt. Experte Volman prognostiziert, dass Afrika im Jahr 2015 mindestens ein Viertel des US-Ölimports decken wird.
US-Außenministerin Clinton reist durch Afrika
Zwischen Wunsch und Wirklichkeit
Elf Tage Afrika - US-Außenministerin Hillary Clinton ist derzeit auf ihrer bisher längsten Auslandsreise unterwegs. Nur ein paar Wochen nachdem Präsident Barack Obama dem Kontinent einen Besuch abstattete, will Clinton deutlich vermitteln: Afrika mit seinen 53 Nationen und knapp 800 Millionen Einwohnern wird von der US-Außenpolitik ernst genommen. Eine Reportage von Konrad Ege.
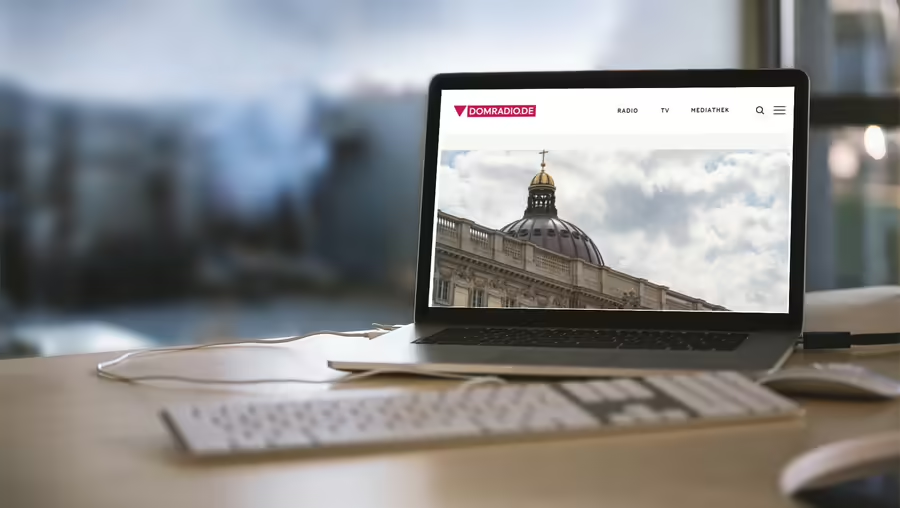
Share on