Das lag nicht nur an seiner kaum zu übertreffenden Präsenz in den Medien und in allen wichtigen Debatten, sondern auch an der hervorragenden Sachkenntnis auf vielen Gebieten und der Prägnanz seiner Rede.
Huber steht für einen streitbaren Protestantismus in der Gesellschaft und für eine «Ökumene der Profile», die die unterschiedlichen christlichen Traditionen in das Gespräch der Konfessionen einbringt und nicht in einem konturlosen ökumenischen Einheitsbrei endet. In diesem Punkt trifft er sich mit dem deutschen Papst Benedikt XVI., der aus katholischer Sicht ebenso zur deutlicheren Profilierung drängt. Zugleich wird hier aber auch das Trennende zwischen den Konfessionen deutlich, wenn Huber von der katholischen Seite die «Achtung des Kircheseins» der Kirchen aus der Reformation einfordert und anmahnt, dass sich die Partner im ökumenischen Dialog «auf Augenhöhe» begegnen.
Innerkirchlich hat Huber dem strukturell eher schwachen Amt des Ratsvorsitzenden neues Gewicht gegeben. Mit dem von ihm vor drei Jahren angestoßenen innerevangelischen Reformprozess werden die Landeskirchen weit über seine Amtszeit hinaus beschäftigt sein, auch wenn die Impulse von «oben» - wie könnte es bei den Protestanten anders sein - nicht überall auf Zustimmung gestoßen sind. Sein Insistieren auf der Qualität des Handelns kirchlicher Amtsträger in Predigt und Gottesdienst, sein Ruf nach einem «Mentalitätswandel» in der Kirche, der noch wichtiger sei als der Strukturwandel und auf eine «missionarische Öffnung» zielen müsse, dürften jedenfalls auch von denjenigen Kritikern akzeptiert werden, die sich an Hubers Diktion reiben.
Dass der frühere Heidelberger Professor einmal Wörter wie «Mission» unbefangen verwenden würde, hätte ihm bei seiner Wahl zum Bischof der damaligen Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg (später kam durch Fusion noch die schlesische Oberlausitz hinzu) 1994 kaum jemand zugetraut. Der profilierte Sozialethiker und frühere Kirchentagspräsident in den von Nachrüstungsdebatten und Friedensethik geprägten Jahren 1983 bis 1985 galt als linker Flügelmann. Eine mögliche Kandidatur zum Bundestag für die SPD schien die logische Fortsetzung dieses Weges zu sein. Die überraschende Wahl zum Bischof brachte dann eine klare Wendung, wenn nicht einen Bruch in der Biografie Hubers.
In kirchenleitender Verantwortung bewegte er sich schnell zur Mitte und bemühte sich, die auseinanderdriftenden Gruppierungen im Protestantismus zu integrieren. Er wandte sich gegen eine «Selbstsäkularisierung» der evangelischen Kirche und hatte keine Berührungsängste mit dem evangelikalen Flügel. Erst kürzlich lobte er in einem Interview den Pietismus und zählte ihn zu den «Kraftquellen», ohne die eine missionarische Kirche nicht auskommen könne. Zugleich betonte er, dass die EKD «nicht ein undifferenziertes Ja» zu allem Evangelikalen sagen könne.
Mit den SPD-geführten Landesregierungen in Berlin und Brandenburg trug Huber harte Kontroversen aus, die er bis zum Bundesverfassungsgericht brachte: über die Stellung des Religionsunterrichts an den Schulen und den Sonntagsschutz. Auch in bundespolitischen Diskussionen war er stets präsent. Beim Stammzellgesetz lieferte er - zum Unverständnis der katholischen Seite - eine entscheidende Vorlage für die letztlich beschlossene vorsichtig liberale Gesetzesnovelle.
Nach der Verabschiedung aus dem Berliner Bischofsamt am 14. November will der agile 67-Jährige zunächst bei einem viermonatigen Forschungsaufenthalt an der Universität in Stellenbosch/Südafrika zum Verhältnis von gesellschaftlicher Pluralität und der christlichen Begründung von Ethik arbeiten. Seinem Nachfolger in Berlin und Brandenburg, Markus Dröge, will er nicht in seine Arbeit hineinreden, aber als «Altbischof» zur Verfügung stehen, wenn er gebraucht wird. Darüber hinaus wird er sich auch künftig in Deutschland als protestantischer Intellektueller zu Wort melden.
Der EKD-Ratsvorsitzende Wolfgang Huber tritt ab
Streitbarer Protestant
Wenn Wolfgang Huber am Mittwoch den Vorsitz des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) abgibt, handelt es sich mehr um eine Zäsur als einen turnusmäßigen Wechsel. Stärker als seine unmittelbaren Vorgänger Manfred Kock, Klaus Engelhardt oder Martin Kruse hat der Berliner Bischof in seiner sechsjährigen Amtszeit dem Protestantismus in Deutschland ein Gesicht gegeben.
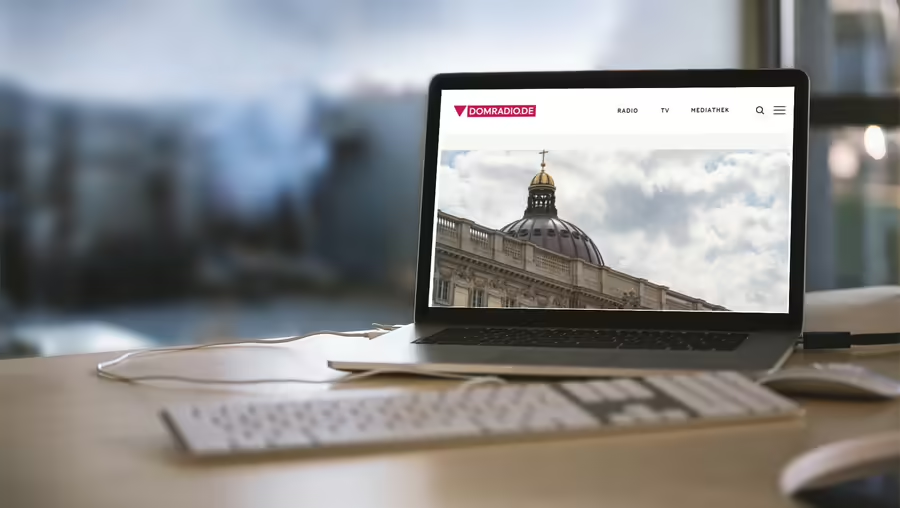
Share on