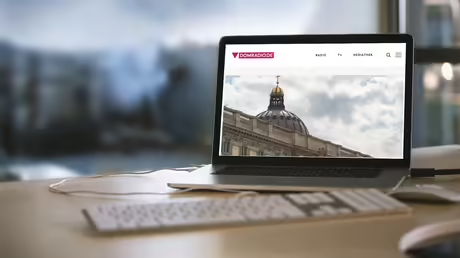"Die meisten Dörfer sind zu 90 Prozent zerstört. Die Wände der Häuser sind zur Seite gekippt und die Dächer einfach zur Erde gefallen", beschreibt der Sprecher der "Aktion Deutschland Hilft" das Ausmaß der Schäden. Wohlrab ist seit dem vergangenen Wochenende in dem Katastrophengebiet, um sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen. Zwölf Mitgliedsorganisationen seien bereits in Westsumatra aktiv. Nach offiziellen Angaben sind bislang mehr als 700 Tote aus den Trümmern geborgen worden. Die indonesischen Behörden befürchten jedoch, dass die Zahl der Toten leicht in die Tausende gehen könnte.
Für die Überlebenden geht unterdessen die Suche nach Unterkünften weiter. Zehntausende leben unter freiem Himmel - bei immer stärker werdenden Niederschlägen, denn in Westsumatra hat gerade die Regenzeit begonnen. Mancherorts kauern 50 Menschen unter einer Zeltplane. In einem Dorf haben Betroffene Unterkunft in einer Moschee gefunden, die das Beben unversehrt überstanden hat. Ein paar Kilometer weiter kampieren Obdachlose unter dem Dach einer Markthalle. "Die ist stark beschädigt und nicht wirklich sicher", sagt Nicole Derbinski, die die Aktivitäten des Malteser Hilfsdienstes im Erdbebengebiet leitet. "Aber besser als nichts ist so etwas allemal."
Erschwert wird die Arbeit der Helfer weiterhin durch Nachbeben und Erdrutsche. Immer noch liegen Trümmer und Schlamm auf wichtigen Zufahrtstraßen. Doch das Engagement scheint ungebrochen. Teilnehmer der regelmäßig anberaumten Koordinierungstreffen berichten von Teams aus aller Herren Länder; ständig tauchten neue Gesichter auf. Manch einer fühlt sich da allerdings an die Situation nach dem Tsunami Ende 2004 erinnert, in der im Eifer des Gefechts und mangels klarer Zuweisungen auch unnütze Projekte in Angriff genommen wurden. "Da herrschte ein echter Overkill an Hilfe", meint ein Mitarbeiter einer Organisation, der namentlich nicht genannt werden will.
Zusammenarbeit mit den indonesischen Behörden
Ein Eindruck, den Malteser-Expertin Derbinski so nicht bestätigen kann. Sie setzt auf die Zusammenarbeit mit den indonesischen Behörden, die weitgehend reibungslos verlaufe. Es gebe Sammelposten für die Hilfsgüter; die Beamten entschieden über die weitere Verteilung. "Sie wissen am Besten, was wo gebraucht wird", sagt Derbinski, und trügen auf diese Weise dazu bei, Ungerechtigkeiten zu vermeiden und blinden Aktionismus einzugrenzen.
Was langfristig in der Region gebraucht wird, muss indes vorerst offen bleiben. Zu ungewiss ist die Zahl der Betroffenen, zu groß das Ausmaß der noch nicht erfassten Schäden. Experten gehen davon aus, dass der eigentliche Wiederaufbau frühestens in zwei Monaten beginnen kann. Manch ein Betroffener mag so lang nicht warten. "Einige haben begonnen, die Mörtelreste von den Steinen ihrer zerstörten Häuser zu klopfen", erzählt ADH-Sprecher Wohlrab.
Ob auch jene Dörfer wieder errichtet werden, die komplett vom Erdboden verschluckt wurden, will die Provinzregierung im Einzelfall entscheiden. Dort, wo keiner der Bewohner überlebt habe, so der zuständige Gouverneur Gamawan Fauzi, erscheine ein Wiederaufbau wenig sinnvoll. "Wenn die Menschen einverstanden sind, könnte man diese Gebiete zu Massengräbern erklären."
Im indonesischen Erdbebengebiet fehlt es an Notunterkünften
Aus Dörfern wurden Massengräbern
"Hin und wieder sieht man doch noch ein heiles Haus", sagt Moritz Wohlrab beinahe ungläubig. Die Zerstörungen durch das schwere Erdbeben, das in der vergangenen Woche die Region um die indonesischen Städte Padang und Pariaman auf Westsumatra heimsuchte, seien gewaltiger, als er sich das habe vorstellen können.
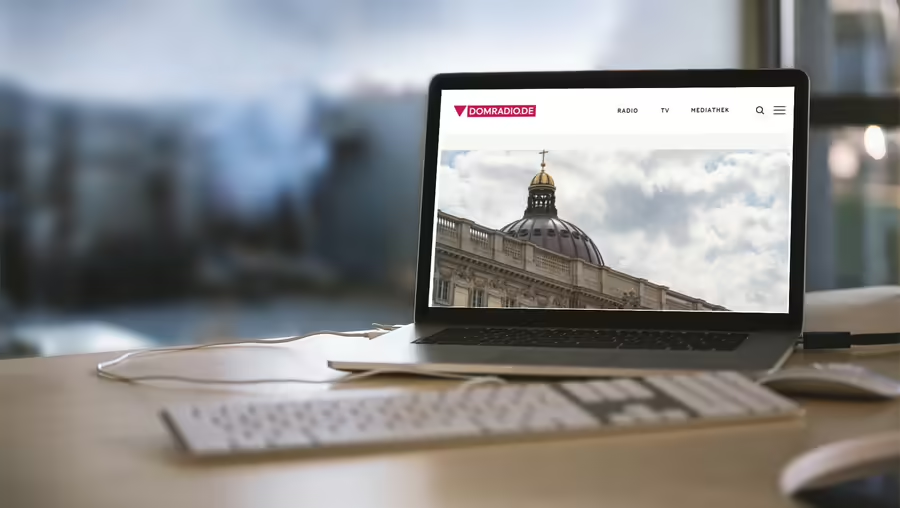
Share on