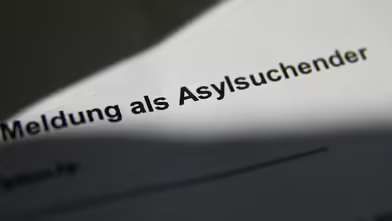domradio.de: Gestern wurde noch einmal bekräftigt - es gilt für die EU das Dublin-Abkommen, das heißt: Flüchtlinge müssen dort einen Asylantrag stellen, wo sie zum ersten Mal Europa betreten. Dieses Abkommen belastet aber zunehmend die Länder an den EU-Außengrenzen. Ist es deswegen nicht dringend reformbedürftig?
Pater Frido Pflüger (Leiter des Jesuiten-Flüchtlingsdienstes): Das kann man sicher sagen. Das Dublin-Abkommen haben wir jetzt in der dritten Phase und es wurde nur noch einmal bestätigt, dass es gilt. Leider hat das Gericht keine Zukunftsperspektiven aufgesetzt. Das Dublin-Abkommen funktioniert einfach nicht. Das große Problem ist, dass die Verteilung nicht klappt, dass es ein großes Hin- und Herschieben von den Leuten ist, dass wir immer wieder das Kirchenasyl brauchen, um die schlimmsten Verletzungen von Menschenrechten zu verhindern, die durch dieses Abkommen geschehen. Und an dem Gespräch gestern Abend zwischen Pinar Atalay und dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann haben Sie die ganze Hilflosigkeit der deutschen Politik gesehen. Er konnte keine einzige richtige Antwort geben oder irgendwelche Lösungen aufzeigen. Es war nur die Wiederholung von den Sätzen, die man seit Jahren hört: Bessere Verteilung, Bekämpfung der Fluchtursachen. Da wird dann immer von den Schleppern gesprochen, aber die sind ja nicht die Fluchtursache.
domradio.de: Versuchen wir das Ganze mal positiv zu drehen. Wie müsste ein System aussehen, das fair mit den Flüchtlingen und den EU-Ländern umgeht?
Pflüger: Die Flüchtlinge erreichen Europa natürlich an den Außenländern, wenn sie über diese ungesicherten Wege kommen, und das wird noch lange Zeit so sein. Das heißt, das Wichtigste wäre, dass Flüchtlinge auf ordentliche, legale und gesicherte Weise nach Europa kommen können und dort ihren Asylantrag stellen dürfen oder nach Beschäftigung fragen. Das wäre das Wichtigste. Aber solche Regelungen haben wir einfach nicht. Die Leute werden nach wie vor ungeregelt nach Europa kommen und dann müsste es ein geregeltes Verteilungssystem geben, aber das gibt es ja nicht. Vor zwei Jahren sollten ja schon hundert- oder hundertfünfzigtausend Leute aus Griechenland und Italien verteilt werden und bis jetzt sind höchstens zwanzigtausend verteilt worden. Es gibt also keinerlei Bereitschaft in Europa voranzugehen. Es wird versucht mit einzelnen Ländern faire Abkommen zu schließen, was schwierig ist, weil die Partnerländer oft keine demokratischen Länder sind.
domradio.de: Das andere große Problem ist "die Fluchtursachen zu bekämpfen". Das ist ja fast schon zu einer Floskel geworden. Warum passiert da nichts? Warum ist das immer nur eine fixe Idee?
Pflüger: "Fluchtursachen bekämpfen" würde heißen, wirtschaftliche Regelungen zu treffen, damit die Wirtschaft in diesen Ländern vorangeht und den Menschen dort eine wirtschaftliche Entwicklung ermöglicht, sodass sie in Frieden und in Würde und in Sicherheit in ihrem Heimatland bleiben können. Das müsste man entwickeln. Aber wir benutzen diese Länder nach wie vor als Materiallieferer für uns und nicht als gleichberechtigte Partner im Wirtschaftswesen.
domradio.de: Jetzt sind Sie im Jesuitendienst, eine christliche Einrichtung, die sich um das Schicksal der Flüchtlinge kümmert. Wie sieht das mit den Kirchen in den EU-Ländern aus: Müssten die mehr tun, um die Politik in ihrem Land zu überzeugen, mehr zu machen?
Pflüger: Ich bin sehr enttäuscht von den Kirchen, vor allem in den osteuropäischen Ländern. Sie nehmen nicht klar genug Stellung gegen diese schlechte Politik, die gegenüber den Flüchtlingen betrieben wird. Diese Politik hat nichts mit dem christlichen Menschenbild zu tun.
domradio.de: Was können die Kirchen da unternehmen?
Pflüger: Die Kirchen könnten ihre Stimmen laut erheben. Die Kirchen könnten von ihren Politikern, die ja zum großen Teil Kirchenmitglieder sind, einfordern, dass sie ihr christliches Selbstverständnis durchsetzen. Und die Kirchen könnten auch ihre ganze Kenntnis und Überzeugungskraft für ihre positive Richtung einsetzen. Aber die sagen entweder gar nichts oder unterstützen diese Politik wie die von Orbán sogar.
Das Gespräch führte Renardo Schlegelmilch.