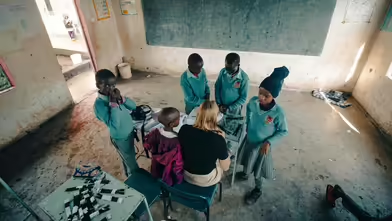DOMRADIO.DE: Die Entwicklungshilfe ist in vielen Ländern beim Auswärtigen Amt angesiedelt, weil Hilfen oft an demokratische Entwicklung oder die Einhaltung von Menschenrechten gekoppelt sind. Was ist aus Ihrer Sicht falsch daran?

Dr. Markus Demele (Generalsekretär von Kolping International): Das ist beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) genauso, es gibt ganz klare Regeln, damit demokratische Kräfte in einem Land starkgemacht werden. Auch beim BMZ geht es nicht darum, Unrechtsregime auf direkte oder indirekte Weise zu stabilisieren.
Aber wenn wir humanitäre Hilfe leisten, also Hilfe in akuter Not, orientiert sie sich an den Werten, die wir teilen. Die besonderen Bedürfnisse von Frauen und Mädchen spielen eine Rolle. Darum würden wir sagen, dass die humanitäre Hilfe und die langfristige Entwicklungszusammenarbeit sinnvollerweise zusammengedacht und zusammengemacht werden müssen.
Wenn man das allerdings im Auswärtigen Amt bündelt, steuert man immer wieder auf Zielkonflikte zu. Außenpolitik und Entwicklungspolitik haben oft genug Zielkonflikte. Ohne ein eigenes Haus, ohne das BMZ, würden mit Sicherheit die kurz- bis mittelfristigen Interessen der Außenpolitik dominieren. Was das BMZ macht, nämlich langfristige Rahmenbedingungen in den Partnerländern zu verändern und nachhaltige Strukturen zu schaffen, würde dann deutlich schwieriger werden.
DOMRADIO.DE: Auch Sie von Kolping International bekommen Gelder vom BMZ. Was würde das für Ihre Arbeit bedeuten?
Demele: Die langfristige Kooperation, die Gestaltung des politischen und gesellschaftlichen Wandels, würde erheblich schwieriger werden. Es würde verlangsamt werden oder sogar ganz ausgebremst werden. Kolping International arbeitet in einem Dreischritt: Wir versuchen, Menschen zu ermächtigen, eigenständig ihren Weg aus der Armut zu schaffen.
Das ist die Voraussetzung dafür, dass sie überhaupt fähig werden, ihre Bedürfnisse angemessen zu artikulieren – das ist dann der zweite Schritt. In einem dritten Schritt, wenn klar ist, dass die Ärmsten der Armen ihre Bedürfnisse selber formulieren können, sollen sie stark gemacht werden, um sich in Politik, Gesellschaft, Kirche und den öffentlichen Dialog einzubringen, damit sie sich nachhaltig für einen Wandel im Namen der Gerechtigkeit einsetzen.
Man wird durch Spenden nicht kompensieren können, was an öffentlichen Mitteln wegfällt, wenn sich diese Kürzungsfantasien der CDU durchsetzen.
DOMRADIO.DE: Inwiefern könnte das dann auch Folgen für uns in Europa und hier in Deutschland haben? Stichwort Fluchtursachenbekämpfung.
Demele: Da sprechen Sie ein Feld an, es gibt noch viele weitere. Ich bin letzte Woche in Honduras gewesen, da sagten mir einige Partner: "Gut, dass ihr noch da seid, USAID und einige ihrer Programme sind jetzt schon weg."
Deutschland muss ein verlässlicher Partner sein. Europa muss das, was an Wertebekenntnissen zu den Menschenrechten in der Welt ist, mit finanziellen Mitteln hinterlegen. Sonst bleiben das hohle Phrasen und die Glaubwürdigkeit würde leiden.
Die Partnerschaften, die durch Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit etabliert sind, nutzen wir auch heute schon, wenn es um den Zugriff auf Bodenschätze geht und wenn es um die strukturelle Anwerbung von Fachkräften geht, die unser Land so dringend braucht. Wir können auf die Partnerschaftsstrukturen der Entwicklungszusammenarbeit aufsetzen. Das würde nachhaltig gefährdet werden, wenn alles zurückgefahren wird.
DOMRADIO.DE: Als katholischer Sozialverband weisen Sie immer wieder darauf hin, dass Entwicklungszusammenarbeit nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein christliches Thema im Sinne weltweit gelebter Solidarität ist. Wundern Sie sich, dass die Kürzungspläne ausgerechnet aus den Parteien kommen, die sich mit dem "C" im Namen auf die christlichen Werte berufen?
Demele: Mit Blick auf die Post-Merkel-Union wundert mich das im Moment nicht. Ich habe den Eindruck, dass es unglaublich viele Politikerinnen und Politiker gibt – übrigens auch aus der Kolping-Tradition heraus –, die sich in der Union engagieren und das mit einer großen persönlichen Überzeugung machen.
Die Partei als Ganze hat aber einen Schwenk Richtung angebotsorientierte Wirtschaftspolitik gemacht. Die normativen Haltelinien bei Menschenrechten, bei der Arbeit, beim Umweltschutz, beim Klimaschutz und jetzt auch bei der Nothilfe für die Ärmsten werden relativ weit unten eingezogen. Da gibt es eine Diskrepanz zwischen den früheren Generationen.
Schauen wir heute in die Nachrichten, sehen wir, dass sich ehemalige Spitzenpolitiker aus CDU und CSU, wie der frühere Wirtschaftsminister Altmaier, Bundestagspräsident Lammert oder Gerd Müller, der frühere Minister des BMZs, für eine gute, eigenständige Entwicklungszusammenarbeit stark machen. Besonders dramatisch ist es zu sehen, wie sich die CDU gegen das Lieferkettengesetz einsetzt, sowohl in Deutschland als auf europäischer Ebene. Es wird ein Bürokratie-Monster imaginiert und erfunden, das es so überhaupt nicht gibt, nur um ein möglichst liberales Regime für Weltkonzerne aufrechtzuerhalten.
Die katholische Soziallehre spricht da eine komplett andere Sprache. Die sagt immer, die Wirtschaft muss den Menschen dienen. Oder Franziskus bringt das knallig ins Wort: Diese Wirtschaft tötet. Ich glaube, Christinnen und Christen müssen sich genau diesem Regime entgegenstellen.
Das Interview führte Hilde Regeniter.