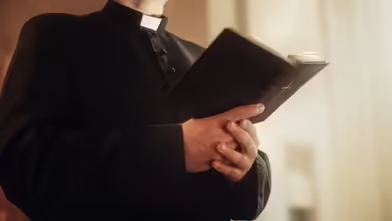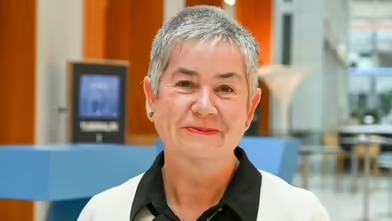Fachkräftemangel beschäftigt die deutsche Politik und Gesellschaft schon seit Jahren. Dass er nicht nur Jobs in Pflege, Handwerk und Ingenieurwesen betrifft, sondern auch in der katholischen Kirche ist ebenso länger bekannt.
Für alle fünf ostdeutschen Bistümer werden in diesem Jahr zwei Neupriester geweiht, im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen werden es nur sieben sein und auch die bayerische Herzkammer des Katholizismus in Deutschland bringt es gerade mal auf zehn Neuweihen, wobei das immerhin eine mehr ist als in den vergangenen beiden Jahren.

Anschaulich ausgedrückt zeigt sich das etwa mit Blick auf die schon vorliegende Kirchenstatistik 2022. Die Zahl der Priester in Deutschland sank erstmals unter 12.000 auf 11.987. Trotz sinkender Mitgliederzahlen machte das immer noch einen Betreuungsschlüssel von einem Priester auf rund 1.750 Katholiken. Damit hat sich deren Zahl pro Priester in den vergangenen 50 Jahren annähernd verdoppelt.
Die Folgen: Defizite in der Seelsorge, Streichung von Gottesdiensten, aber auch Überforderung: In den durch Zusammenlegung größer werdenden Pfarrgemeinden wird die Last auf weniger geweihte Schultern verlagert.
Erwartungshorizont gegen Arbeitsrealität
Wie kann dem beigekommen werden, wie das Interesse am Priesteramt wieder gesteigert werden? Zu diesem Zweck hat die Deutsche Bischofskonferenz das der Uni Bochum angeschlossene Zentrum für angewandte Pastoralforschung (zap) mit einer Studie beauftragt.
Um herauszufinden, wie gerade die jüngere Generation Priester ihre Ausbildung, Motivation und ihr Amtsverständnis einschätzen, kontaktierten die Forscher um zap-Leiter Matthias Sellmann zwischen Oktober 2021 und Februar 2022 2.515 Personen, darunter alle 847 Priester, die zwischen 2010 und 2021 geweiht wurden, sowie alle 1.668 Männer, die in diesem Zeitraum das Priesterseminar verlassen haben.

Teilgenommen haben letztlich nur 153 geweihte Priester sowie 18 Seminarabbrecher - eine Rücklaufquote von 6,8 Prozent. Die zentrale und vor dem oben beschriebenen Horizont vielleicht ernüchterndste Erkenntnis daraus: Zwischen dem, was Priester von ihrer Ausbildung und Arbeitsgestaltung erwarten und dem, was von ihnen in Gemeinden erwartet wird, klaffen offenbar große Lücken.
Denn wer in Deutschland als Priester die Funktion als leitender Gemeindepfarrer übernimmt, dem kommt nicht nur die Aufgabe zu, Messen zu feiern und Sakramente zu spenden. Von ihm werden auch Verwaltungsaufgaben erwartet: Priester sitzen in Kirchenvorständen, entscheiden mit über Finanzen, Personal sowie die Nutzung der mancherorts nicht wenigen Grundstücke der Kirchengemeinde.
Spiritualität schlägt Administration
Bei den Ansprüchen, die die Teilnehmer an ihre Ausbildung hatten, stehen laut Studie nun aber die eigene Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität mit jeweils 71,7 und 63,2 Prozent recht weit oben auf der Liste. Auch die seelsorgerische Begleitung wird mit 69,1 Prozent als sehr wichtig wahrgenommen.
Aufgaben des Gemeindemanagements liegen dagegen weit dahinter zurück: Nur 39,5 Prozent wünschten sich für die Ausbildung etwa mehr Gewichtung für die Einführung in die kirchliche Verwaltung.
Gefragt nach ihren Schwerpunkten in der Ausbildung, sagten nur 6,1 Prozent, dass sie in praktischen Belangen sehr gut vorbereitet wurden. 30,4 Prozent bewerteten sie immerhin noch als gut, 22,3 Prozent jedoch als schlecht und 5,4 Prozent sogar als sehr schlecht.
Ein umgekehrtes Bild bei der theologischen Ausbildung: Diese wird von 36,2 Prozent als sehr gut sowie von 45 Prozent als gut wahrgenommen - bei nur 0,7 Prozent, die sie als sehr schlecht bezeichnen.

Der Verantwortliche für die Priesterausbildung in der Bischofskonferenz, der Fuldaer Bischof Michael Gerber, bewertete den Wunsch nach mehr Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität zunächst als etwas Positives. Er könne "vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt und geistlichem Missbrauch in unserer Kirche nur nachdrücklich begrüßt und gefördert werden".
Gleichzeitig kündigte er an, die Studienergebnisse kritisch reflektieren zu wollen. Die Wünsche angehender Priester sollen auch in der neuen Ausbildungsrahmenordnung Niederschlag finden, die derzeit in Absprache mit Rom finalisiert werde. Wann diese jedoch vorgelegt wird und welche Änderungen sie enthält, darüber kann die Bischofskonferenz noch keine Angaben machen.
Folgen für den Synodalen Weg
Deutlich weniger positiv lässt sich hingegen die Reaktion des obersten Laiengremiums in Deutschland, des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) an. "Die Kirche muss sich selbst verändern, um Antworten auf die Fragen und Bedürfnisse der Menschen zu geben", sagte ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).
Wenn weiterhin keine geeigneten Kandidaten gefunden würden, müsse die Kirche sich selbst und ihre Attraktivität für junge Männer hinterfragen.
Wobei die Fokussierung nur auf Männer dabei natürlich schon ein Problem darstellt, wie die ZdK-Präsidentin weiter ausführt: "Leitung und Führung sind nicht per se männlich." Damit greift sie eines der zentralen Anliegen des kirchlichen Reformprozesses in Deutschland, des Synodalen Wegs, auf. Für dessen Fortgang - auch das wird deutlich - bedeuten die Ergebnisse der Befragung wenig Gutes.

"Wenn der Synodale Weg mittel- und langfristig erfolgreich sein soll, braucht es eine katholische Kirche, die nicht zuletzt ihr Leitungs- und Führungspersonal für die Anforderungen des 21. Jahrhunderts ausbildet", betont Stetter-Karp. "Junge, innovative und visionäre Priester sind nach meiner Erfahrung leider in der Minderheit. Sie müssen zur Mehrheit der Priester werden."
Auch Studien-Autor Sellmann stellte klar, dass nach den Studienergebnissen die junge Priesterschaft definitiv nicht zum Träger einer Reformbewegung werden könne. Zwar sagten nur 4,6 Prozent, dass Reformen nicht nötig seien. Über 80 Prozent finden aber, dass es mehr Angebote mit spirituellem Tiefgang brauche, drei Viertel wünschten sich eine stärkere Ausrichtung auf die Vermittlung von Glaubensinhalten.
Hingegen meinten jeweils nur rund 30 Prozent, dass es eine Reform der kirchlichen Amtsautorität brauche oder das der Zölibat abgeschafft werden müsse. Gerade letzterer Befund ist für den Hintergrund interessant, dass rund 73 Prozent Ehelosigkeit und Zölibat als maßgebliche Hindernisse für die Entscheidung zum Priesteramt betrachten.
Bestätigung für Traditionalisten
Ein entsprechend gegenteiliges Echo erzeugt die Studie in traditionalistischen Kreisen, die dem Synodalen Weg kritisch bis ablehnend gegenüberstehen. Der Befund, dass junge Priester die Reform offenbar nicht mittragen und sich stattdessen mehr auf ihren Verkündigungsauftrag konzentrieren wollen, wird als Bestätigung der Kritik an dem auch als spalterisch wahrgenommenen Synodalen Weg gewertet.
Untermauern lässt sich diese Deutung auch dadurch, dass Priester laut der Studie inzwischen aus einem recht homogenen sozialen Milieu der Mittelschicht stammen, deren christliche Prägung nicht mehr so stark ist wie in den vorkonziliaren 1960er Jahren. Sie sind "Überzeugungstäter", ihre Antworten in der Umfrage könnten entsprechend en bloc gewertet werden.
Dass das ZdK oder Sellmann die Ergebnisse als problematisch für die Kirche ansehen, wird von konservativer Seite eher als negatives Framing der Jungpriester angesehen. Schließlich stellten diese die Zukunft der Seelsorge dar.
Abseits der Diskussion um Sinn und Unsinn des deutschen Reformdialogs hat diese Interpretation jedoch den erkennbaren Schönheitsfehler, dass sie das Verhältnis von Ausbildung zu Beruf mit dem falschen Gefälle betrachtet. Eine Ausbildung hat den Zweck, möglichst gut und umfassend auf den Job vorzubereiten, andersherum hat sich der Job nicht nach den Kriterien der Ausbildung zu richten.
Wenn Priester also weiterhin als Gemeindepfarrer auch administrative Aufgaben übernehmen sollen, muss dies auch im Seminar entsprechend berücksichtigt werden. Dass die befragten Priester diesen Nachholbedarf erkennen, untermauern die oben genannten Zahlen der Studie.
Mehr Kompetenz für Laien?
Eine mögliche Lösung, für die sind interessanterweise Reformbefürworter wie -gegner auf gewissen Weise offen, wäre eine Aufteilung administrativer Gemeindeleitung auf mehrere Schultern im Verbund mit Laien.
Während die einen sich dadurch eine Aufhebung des Machtgefälles und eine stärkere Einbindung insbesondere von Frauen erhoffen, sehen andere die Möglichkeit, dass Priester sicher stärker auf die Seelsorge konzentrieren können - wobei letzteres auch auf Kosten einer Pfarrgemeinde als gesellschaftliche Größe abseits des Gottesdienstes gehen könnte.

Welche weiteren Erkenntnisse nun aus der Studie folgen ist noch offen. Genaueres wird sich erst nach Vorlage der angekündigten neuen Rahmenordnung sagen lassen. Studien-Leiter Sellmann plädierte dennoch schon dafür, die Befragung als Langzeituntersuchung anzulegen.
"Das würde heißen, dass man in bestimmten Abständen eine solche Studie durchführt", sagte er im Interview dem Portal katholisch.de. "Das wäre eine wichtige Innovation, weil man dadurch einen längerfristigen Datenbestand aufbaut, der es erlaubt, noch robustere strategische Empfehlungen abzugeben."
Interessanteste Gruppe unterrepräsentiert
Doch wie aussagekräftig wird das am Ende sein? Denn bei allen Interpretationen bleibt der Studie ein Makel. In ihr ist insbesondere die vermeintlich interessantere der beiden befragten Gruppen, die der Seminarabbrecher, kaum repräsentiert.
Zwar haben im Betrachtungszeitraum 1.668 Männer das Priesterseminar verlassen, mit 18 Studienteilnehmern liegt die Rückmeldungsquote allerdings gerade mal bei gut einem Prozent.
Die Studienautoren führen das auf eine vergleichsweise schwierigere Akquise zurück, da im Gegensatz zu den geweihten Priestern für die Abbrecher keine systematisch gepflegte Datenbank vorliegt. Der Kontakt erfolgte so über Organisationen, Soziale Medien oder private Bekanntschaften. Damit kann kaum Anspruch auf Vollständigkeit erzielt werden.
Das ist nachvollziehbar, jedoch nicht weniger bedauerlich. Für eine umfassende Antwort darauf, welche Defizite die Ausbildung aus Sicht der angehenden Priester hat, wäre die Sicht derer, die sie aus welchen Gründen auch immer abgebrochen haben, hilfreich gewesen.