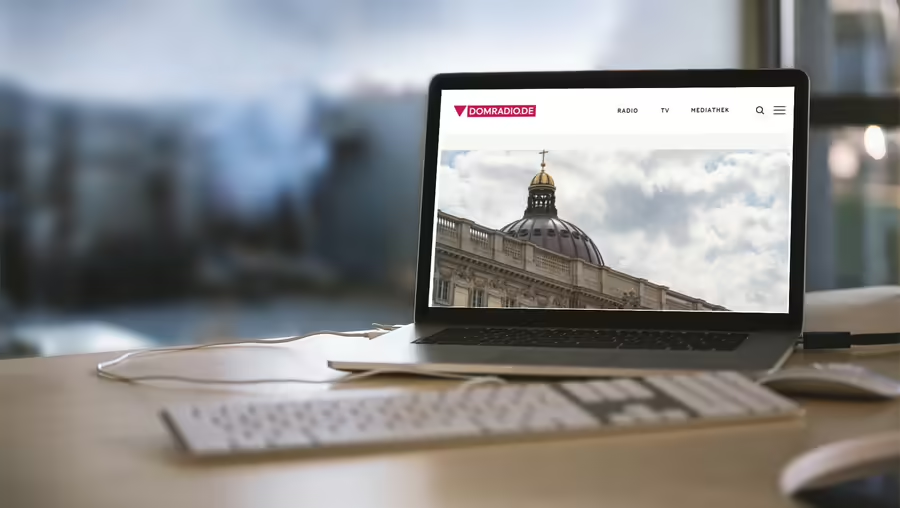Als Papst Johannes Paul II. im April 1990 in die Tschechoslowakei reiste, wurde er von einer Sympathiewelle getragen. Es war seine erste Reise überhaupt in ein Land des früheren Ostblocks nach der "Wende". Erst kurz davor waren die diplomatischen Beziehungen zwischen der nachkommunistischen Tschechoslowakei und dem Heiligen Stuhl wieder aufgenommen worden.
An den öffentlichen Schulen wurde wieder Religionsunterricht möglich. Die Theologischen Fakultäten wurden wieder den Universitäten Prag und Bratislava eingegliedert, eine neue in Olmütz gegründet. Es gab die unglaubliche Zahl von 869 Theologiestudenten im tschechischen Landesteil; in der Slowakei war die Zahl noch weit höher.
Ernüchterung stellte sich ein
Der spätere Prager Kardinal Miloslav Vlk (1932-2017) bekam feuchte Augen, als er Jahre darauf auf diese Zeit angesprochen wurde: "Wir haben geglaubt, dass die Menschen, vor allem die jungen, uns nach der Papst-Visite als neue Gläubige die Kirchentore einrennen werden." Immerhin waren es auch viele Christen gewesen, die dem Drang nach Freiheit 1989 wichtige Impulse gaben.
Doch die Ernüchterung ließ nicht lange auf sich warten. Der polnische Papst legte bei seinem Besuch vor allem Wert auf eine politische, eine demokratische Erneuerung. Über die geistige Erneuerung sprach er eher wenig. Wohl auch, weil es gerade in der katholischen Kirche der Tschechoslowakei eine Reihe spezieller Probleme gab, derer man sich in Rom nur schwer anzunehmen vermochte.
Was etwa sollte aus der von den über 40 Jahre herrschenden Kommunisten unterwanderten Kirche der "Friedenspriester" werden? Und was aus den im Sozialismus geheim geweihten Priestern, von denen nicht wenige verheiratet waren - oder gar Frauen? Während man einige der dringendsten personellen Probleme an der kirchlichen Basis lösen konnte, Restitutionsfragen anging, Religionsfreiheit verankerte und die Kirchen von staatlicher Bevormundung befreite, dräute ein völlig neuer Konflikt: Zwischen Tschechen und Slowaken kamen nationale Stimmungen auf.
Die Slowaken wollten mehr Eigenständigkeit, wehrten sich gegen den harten wirtschaftlichen Reformkurs der Tschechen - der die Slowakei noch mehr traf als Böhmen und Mähren. Die Spitzenpolitiker beider Landesteile, Vaclav Klaus und Vladimir Meciar, sahen im August 1992 weniger Gemeinsames als Trennendes - und so gaben sie Grünes Licht für die Teilung des Landes. Vor 25 Jahren, am 25. November 1992, folgte das tschechoslowakische Parlament.
Kirche von Teilung nicht begeistert
Die katholische Kirche im tschechischen Landesteil hatte vor diesem Schritt gewarnt. Sie räumte aber ein, dass die Slowaken in den Jahrzehnten des Zusammenlebens benachteiligt worden seien. Kardinal Vlk bat die Slowaken dafür sogar im Fernsehen um Vergebung. Auch die slowakischen Bischöfe sprachen sich gegen die Trennung aus. Sie traten aber dem neu aufbrechenden Nationalismus in ihrem Landesteil auch nicht entschieden entgegen; am Ende begrüßten sie gar die slowakische Souveränitätserklärung.
In der Silvesternacht 1992 endete der gemeinsame Staat. Die neu entstandene Tschechische Republik wurde so über Nacht zum vielleicht "atheistischsten Land" Europas. 1991 bezeichneten sich 60 Prozent der Slowaken als katholisch, aber nur 40 Prozent der Tschechen. Gingen in der Slowakei 29 Prozent der Gläubigen zum Gottesdienst, waren es im tschechischen Landesteil gerade mal 10 Prozent. Damit schlugen die Tschechen sogar die Ex-DDR statistisch aus dem Feld.
Die Vorgeschichte: Im heutigen Tschechien hatten die Habsburger über Jahrhunderte die Böhmen und Mähren rekatholisiert - gegen deren Willen. Mit den Sudetendeutschen wurde zudem nach dem Zweiten Weltkrieg eine christliche Bevölkerungsgruppe vertrieben. In der Slowakei dagegen gab es immer eine starke katholische Volkskirche, die auch unter den Kommunisten weitgehend durchhielt.
Dramatische Folgen für die Kirche hatte die Teilung der Tschechoslowakei am Ende nicht. Der österreichische Religionsjournalist Peter Musyl sieht den Grund dafür darin, dass ohnehin "die beiden nach Geschichte und kirchlicher Prägung unterschiedlichen Landesteile seit der Gründung der Tschechoslowakei 1918 nie wirklich zusammengewachsen" seien.