DOMRADIO.DE: Die Überschrift Ihres Vortrages lautet "Leben als Dauerkrise". Stecken wir wirklich in einer Dauerkrise oder meinen wir das nur?
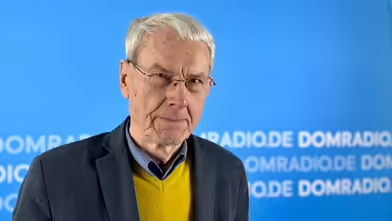
Dr. Albert Wunsch (promovierter Erziehungswissenschaftler, Psychologe, Dipl.-Pädagoge, systemischer Familientherapeut und Paar- und Erziehungsberater): Beides. Auf der einen Seite gibt es ganz viele Menschen, die innerlich einen Krisenmodus haben. Da werden relativ normale Nachrichten direkt auf das Krisenkonto gebucht. Auf der anderen Seite haben wir eine Verdichtung in der Weltpolitik. Ich habe den Eindruck, das ist ganz schön arg. Da nicht selbst in eine Dauerkrise zu geraten, ist trotzdem eine unwahrscheinliche Notwendigkeit. Deshalb möchte ich diesen Vortrag dazu nutzen, um ein paar Impulse zu geben.
DOMRADIO.DE: Warum geben uns digitale Medien das Gefühl, dass alles eine Krise ist?
Wunsch: Die Art und Weise spielt dabei eine große Rolle. Medien fordern zum Handeln auf, tragen aber selbst zur Zuspitzung bei. Überschriften sind oft einseitig und polarisierend, während erst im weiteren Text eine sachliche Einordnung folgt, ein klarer Widerspruch. Wünschenswert wäre eine Berichterstattung, die Krisen sachlich erklärt, statt sie zusätzlich anzuheizen.
DOMRADIO.DE: Neben den Nachrichten gibt es auch das echte Leben. Wenn dann noch eine Krankheit, eine Ehekrise oder ein anderes Problem hinzukommt, wie kann man damit umgehen?
Wunsch: Schritt für Schritt. Dann muss man sehen, ob der Schritt jetzt in Richtung große Weltkrise geht oder ob der Schritt daraufhin bezogen ist, sein eigenes Leben auf die Reihe zu kriegen. Da werden sich die meisten Menschen auf das eigene Leben beziehen. Denn wer das eigene Leben nicht auf die Reihe kriegt, für den hat das andere sowieso keine Bedeutung mehr.
DOMRADIO.DE: Resilienz ist ein Wort, das wir spätestens nach Corona immer wieder gehört haben. Wenn man doch resilient ist, dann kann man viel besser mit allem umgehen. Wie kann man denn resilient werden?
Wunsch: Man sollte sich nicht von der Faszination blenden lassen und auch nicht zu viele Bücher lesen, die den Begriff erklären. Denn davon gibt es einige. Ich selbst habe ein Buch geschrieben, das Beispiele zeigt, wie Menschen resilient wurden und Tipps gibt, wie man Resilienz trainieren kann. Resilienz entsteht nicht in einer Wohlstandsgesellschaft, in der es an nichts fehlt, sondern durch das Erleben von Mangel. Wenn die Gesellschaft uns diesen Mangel nicht bietet, müssen wir ihn selbst schaffen.
Ein einfaches Beispiel: Wenn man morgens unter der Dusche steht, freut man sich über das warme Wasser. Aber diese Freude spürt man nur, wenn man Mangel erfahren hat. Jedoch sollte man Mangel nicht als Mangel belitten haben. Das Wort gibt es nicht, aber es trifft den Kern gut. Es heißt so viel wie zur Kenntnis genommen haben und damit Umgang gelernt haben. Die Menschen müssen sich selbst Mangelsituationen schaffen. Da sind wir schon beim christlichen Ideal. Fastenzeiten sind bewusst auferlegter Mangel. Sie helfen uns, später umso mehr zu schätzen, was wir im Alltag oft als selbstverständlich nehmen.
DOMRADIO.DE: Das heißt ab und zu mal kalt duschen tut gut?
Wunsch: Insgesamt viel stärker Dinge wahrnehmen. Wenn es in der Wohnung 18 Grad sind, freut man sich über 20 Grad. Hat man 15 Grad freut man sich über 18 Grad. Diese Wahrnehmung passt auch zu den großen Weltkrisen. Während der Nachhaltigkeitsdebatte, die durch den Ukraine-Krieg und den Energiemangel verstärkt wurde, hat mich eines immer gewundert: Niemand forderte die Menschen aktiv dazu auf, ihren eigenen Verbrauch deutlich zu reduzieren. Würden wir ein Drittel weniger konsumieren, würden die Preise ebenso um ein Drittel sinken und jeder Einzelne müsste weniger ausgeben. Wir müssen begreifen, dass Mangel eine Voraussetzung von Fülle ist.
DOMRADIO.DE: Sie haben Religion, Kirche und Fastenzeit angesprochen. Gibt es weitere Punkte, wo Religiosität helfen kann, mit Dauerkrisen umzugehen und die Resilienz zu stärken?
Wunsch: Ich habe zuletzt eine Frau begleitet, die fünf Jahre lang mit Krebs lebte und ihren Krankheitsverlauf auf eine ganz eigene Weise bewältigte. Für sie war der Krebs kein Feind, sondern eine Realität, mit der sie umgehen musste. Auch die Chemotherapie sah sie nicht als Bedrohung, sondern als Gefährten im Kampf gegen die Krankheit. Ihr Glaube gab ihr dabei Halt. Sie war sich bewusst, dass der Tod unausweichlich ist, ob früher oder später und dass die letzten Stunden immer eine Herausforderung sein würden. Dennoch nahm sie das Ungewisse mit tiefem Gottvertrauen an.
Das Interview führte Uta Vorbrodt.







