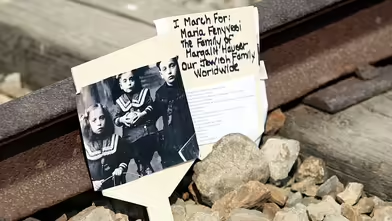Bleiben oder gehen? Dieser doppelte Impuls prägt die Biografie von Charlotte Knobloch. Auch wenn es manchmal knapp war, hat sich die Münchner Jüdin und deutsche Patriotin letztlich immer wieder fürs Bleiben entschieden, fürs Wiederaufbauen und Standhalten - allen Anfechtungen zum Trotz. Zu ihrem 85. Geburtstag am 29. Oktober hat sie nur einen Wunsch: Normalität.
Der klingt so bescheiden, ist es aber nicht. Dazu genügt ein kurzer Blick auf ihre Lebensgeschichte. Den Holocaust überlebt die Tochter des Rechtsanwalts Fritz Neuland nur durch eine List: Eine ehemalige Hausangestellte ihres Onkels, eine Katholikin, nimmt sie mit in ihre fränkische Heimat und gibt sie dort als ihre uneheliche Tochter aus. Charlottes Großmutter, bei der sie nach der Scheidung der Eltern aufgewachsen ist, wird im Konzentrationslager Theresienstadt ermordet.
Auswanderung nach Amerika ist beschlossen
Nach dem Krieg kehrt die junge Frau nach München zurück und heiratet 1951 den Kaufmann Samuel Knobloch, einen Überlebenden des Krakauer Ghettos. Die Auswanderung nach Amerika ist beschlossene Sache. Schnell absolviert sie noch eine Lehre zur Schneiderin, dann wird sie schwanger; die Ausreise fällt aus.
Wenn die kleine, resolute Frau heute aus dem Fenster des Jüdischen Gemeindezentrums am Jakobsplatz schaut, fällt der Blick auf ihren Stein gewordenen Lebenstraum: die neue Hauptsynagoge, deren Bruchsteinfassade an die Klagemauer des salomonischen Tempels erinnert - ein Stück Jerusalem mitten in München, ein Stück wiedergewonnene Normalität jüdischer Existenz in der einstigen "Hauptstadt der Bewegung".
Koffer ausgepackt
Die Grundsteinlegung für den Bau hat Knobloch bewusst auf den 9. November 2003 terminieren lassen. 65 Jahre nach der sogenannten Reichspogromnacht soll dieses Datum für die langjährige Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern eine neue, zusätzliche Bedeutung erhalten, auch für sie persönlich: "Ich bin angekommen, ich habe meinen Koffer ausgepackt."
Knapp 10.000 Mitglieder umfasst ihre Gemeinde heute. Es gibt einen jüdischen Kindergarten, eine Grundschule, vor einem Jahr nahm ein Gymnasium seinen Betrieb auf. Alles Schritte zu mehr Normalität. Im Juli konnte Knobloch das 20-jährige Bestehen des Lehrstuhls für Jüdische Kultur und Geschichte an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität mitfeiern. Die Festrede hielt der muslimische Schriftsteller Navid Kermani - und er beschloss sie mit der Hoffnung "auf eine Zukunft, in der Deutschland wieder jüdischer wird".
Zwölf-Stunden-Arbeitstage
Anfang September wurde der Erinnerungsort für die Opfer des Attentats auf die israelische Olympia-Mannschaft von 1972 seiner Bestimmung übergeben. Spät, aber nicht zu spät, sagten viele. Und auch Knobloch konnte wieder einmal mit Genugtuung feststellen, dass sich Beharrlichkeit am Ende eben doch auszahlt. Für das Ehrenamt an der Spitze der jüdischen Gemeinde in der bayerischen Landeshauptstadt investiert sie Zwölf-Stunden-Arbeitstage. Manchmal wird es auch später, aber das ist für sie völlig normal. "Ich habe ja sonst keinerlei Aufgabe."
Sich ausruhen und zufrieden zurücklehnen ist Knoblochs Sache nicht. Auch, weil das Erreichte inzwischen wieder bedroht erscheint. Der erstmalige Einzug rechtsradikaler Abgeordneter in den Bundestag hat ihr unlängst Alpträume beschert - und dunkle Erinnerungen an 1933. Nie hätte sie gedacht, noch einmal solche Diskussionen in Deutschland führen zu müssen. "Wir gehen härteren Zeiten entgegen", befürchtet Knobloch.
Kampf für Menschenrechte
Doch so lange sie kann, wird sich die Grande Dame des Judentums in Deutschland weiter zu Wort melden, auch wenn sie sich bisweilen vorkommt wie die "Stimme eines Rufers in der Wüste". Denn es gibt da diesen nicht ausrottbaren Wunsch in ihr: "Dass jemand, der hier leben will, nicht mehr nach seiner Religion, seiner Abstammung oder Hautfarbe gefragt wird, sondern dass er als der Mensch beurteilt wird, der er ist."