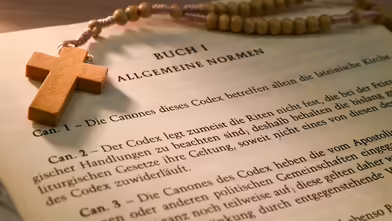Darf ein Bistum Namen von Gestorbenen veröffentlichen, denen sexueller Missbrauch oder dessen Vertuschung vorgeworfen wird? Nicht erst seitdem das Bistum Aachen dies im Oktober 2023 getan hat, wird das auch kirchenrechtlich diskutiert. Schon der im Jahr 2002 publik gewordene Skandal in der Erzdiözese Boston sowie spätere Listen weiterer US-Bistümer mit "glaubhaft Beschuldigten" (credibly accused) warfen diese Frage auf. Dazu wurde nun unlängst eine Antwort des vatikanischen Justizministeriums – des Dikasteriums für die Gesetzestexte – bekannt.
In einem Schreiben vom 5. September 2024 antwortet die Behörde auf die Anfrage eines ungenannten Klerikers vom 3. Juli desselben Jahres. Dieser wollte wissen, wie "der gute Ruf eines Verstorbenen im derzeitigen kirchenrechtlichen Kontext" geregelt sei. Hintergrund der Anfrage ist die kirchliche Missbrauchsaufarbeitung. Die konkrete Anfrage könnte aus den USA stammen; dort werden aufgrund von Anschuldigungen auch gegen Gestorbene mitunter hohe Schadensersatzforderungen an Diözesen gestellt. Zudem sind die Kriterien bei der Einstufung von Vorwürfen gegen "glaubwürdig Beschuldigte" umstritten.
Kanon 220 maßgeblich
Die vatikanische Antwort, unterzeichnet vom Präfekten und vom Sekretär der Behörde, Filippo Iannone und Juan Ignacio Arrieta, stützt sich vor allem auf Kanon 220 des allgemeinen Kirchenrechts (CIC). Darin heißt es, dass "es niemandem erlaubt ist, den Ruf, den er genießt, unrechtmäßig zu schädigen". Zwar könne "in einigen Fällen die Schädigung des guten Rufs legitim sein", so das Schreiben. Dies sei etwa der Fall, "um eine Gefahr oder Bedrohung für Personen oder die Allgemeinheit zu vermeiden".
"Im Fall verstorbener mutmaßlicher Straftäter" seien eine solche Gefahr oder Bedrohung hingegen ausgeschlossen, weswegen es "weder einen legitimen noch verhältnismäßigen Grund für die Rufschädigung geben" könne. "Daher erscheint es nicht zulässig, die Veröffentlichung solcher Nachrichten aus angeblichen Gründen der Transparenz oder der Wiedergutmachung zu rechtfertigen."
Bistum Aachen wertet Transparenz höher
Das Bistum Aachen hingegen bewertet das Aufklärungs- und Informationsinteresse von Betroffenen höher. "Wir handeln transparent, konsequent und umfassend. Kein Täter soll unentdeckt bleiben", so der damalige Generalvikar Andreas Frick. Neben den rechtlich unstrittigen Fällen der staatlichen oder kirchenrechtlichen Verurteilung eines Täters, nennt die Diözese als Kriterium "mindestens einen positiv beschiedenen Antrag auf Anerkennung des Leids von der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) auf Bundesebene".
Ein durch Plausibilitätsprüfung erfolgter Bescheid stelle einen "hinreichenden Tatverdacht für die Annahme dar, dass es sich um einen mutmaßlichen Täter handelt". Voraussetzung für die namentliche Nennung sei "aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes, dass die Person vor mehr als zehn Jahren verstorben ist".
Die Rechtsexperten des Dikasteriums sehen dies anders. Das grundlegende rechtliche Problem sei nicht, dass Tote sich gegen Anschuldigungen nicht mehr wehren könnten. Vielmehr verstoße die posthume Nennung gegen zwei allgemeine anerkannte Rechtsgrundsätze, die "vernünftigerweise nicht durch ein allgemeines 'Recht auf Information' außer Kraft gesetzt werden" könnten: "1. den Grundsatz der Unschuldsvermutung bis zum – gerichtlichen – Beweis des Gegenteils und der Endgültigkeit (siehe auch Kanon 1321 §1); 2. den Grundsatz der Nichtrückwirkung der Straftat, wonach man nicht für ein Verhalten verurteilt – und folglich auch nicht angeklagt – werden kann, das zum Zeitpunkt seiner möglichen Begehung formal gesehen keine Straftat darstellte." Dies gelte etwa auch "bei der sogenannten Unterlassung von allgemeinen Sorgfaltspflichten".
"Relativ niedriger Standard an Beweisen"
Im Übrigen beruhten Anschuldigungen oft auf nicht-kirchenrechtlichen Grundlagen mit "relativ niedrigem Standard an Beweisen". Dies führe dazu, "dass der Name einer Person, die lediglich beschuldigt wird – aber unbewiesen beschuldigt –, veröffentlicht wird, ohne dass das Recht auf Verteidigung ausgeübt werden kann". In seiner Begründung verweist die Behörde auf eine Papst-Ansprache beim Anti-Missbrauchsgipfel 2019. Damals hatte Franziskus unter anderem erklärt, die Veröffentlichung von Beschuldigten-Listen, auch durch Diözesen, sei zu unterlassen, solange keine endgültige Verurteilung vorliege.

Mit der Entscheidung liegt das Dikasterium auf einer Linie mit dem Bonner Staatsrechtler Josef Isensee, der gegenüber der KNA bezweifelte, dass Plausibilität eine "zureichende und passende Kategorie" sei, um "mutmaßliche Täter" nennen zu dürfen. Mit einer Plausibilitätsprüfung werde nur auf Schlüssigkeit des Vortrags, nicht aber auf Übereinstimmung mit der Realität abgehoben.
"Von Vertuschung zu illegitimer Publikation"
Plausibilität reiche damit niemals – ebenso wenig wie das bischöfliche Ansinnen, Bußfertigkeit und amtliche Reue demonstrieren zu wollen –, um den Eingriff in das Persönlichkeitsrecht zu legitimieren. Weiter warf Isensee der Kirche vor, durch eine solche Praxis "vom Fehler der Vertuschung des Übels in den Fehler illegitimer Publikation" überzugehen.
Für die Aufarbeitung von Missbrauch durch Diözesen ergeben sich dadurch Probleme. Hinweise seitens der Kirche in die Öffentlichkeit, mögliche weitere Betroffene mögen sich melden, sind nach Ansicht von Stefan Schweer, Kanonist am Offizialat in Osnabrück, so kaum noch möglich. Einzig, wenn Vorwürfe auf nicht-kirchlichen Wegen in die Öffentlichkeit gelangt sein sollten, wäre eine derartige Aufforderung denkbar.
Die Realität werde sich nur schwer mit der grundsätzlichen Regelung des Dikasteriums in Einklang bringen lassen. In der Interventionsordnung der Deutschen Bischofskonferenz heißt es unter Ziffer 56: "Die Öffentlichkeit wird unter Wahrung des Persönlichkeitsschutzes der Beteiligten in angemessener Weise informiert."
Heikle Fragen zum Eintrag ins Taufregister
In einer zweiten Entscheidung vom 25. Oktober reagiert das Dikasterium für die Gesetzestexte auf Fragen eines Bischofs zum Eintrag ins kirchliche Taufregister in drei unterschiedlichen Fällen: 1. "wenn das Kind das leibliche Kind einer Person ist, die in einer homosexuellen Verbindung lebt, oder von einem homosexuellen Paar adoptiert wurde", oder 2. "die Frucht einer heterologen Befruchtung, einer 'Leihmutterschaft' ist"; sowie 3. die Frage, wie Personen, die sich hormonellen Eingriffen und Operationen zur Geschlechtsumwandlung unterzogen haben, ins Taufregister eingetragen werden sollen.
Antworten auf diese "äußerst heiklen Fälle von großer Aktualität" verlangen laut Dikasterium Entscheidungen auf nationaler Ebene, also meist der zuständigen Bischofskonferenzen. Diese solle entscheiden, ob sie dazu Regelungen brauche, und den Vatikan um die Vollmacht ersuchen, solche Regeln zu erlassen. Für die Deutsche Bischofskonferenz existiert bisher keine einheitliche Regelung.
In einigen Diözesen werden – um staatlichen Vorgaben zu genügen – Eltern von Täuflingen nicht mit "Vater" und "Mutter" eingetragen, sondern als "Elternteil 1" und "Elternteil 2". Bei adoptierten Kindern werden in manchen Diözesen die Adoptiveltern als Eltern eingetragen, und die leiblichen unter "Bemerkungen"; in anderen Bistümern ist es umgekehrt.
Regelungen für Alleinerziehende und Unverheiratete
Das Erzbistum Freiburg hatte bereits 2022 ein allgemeines Ausführungsdekret zum Taufbucheintrag in besonderen Fällen erlassen. Allerdings betreffe dies nur sehr wenige Fälle, etwa ein bis zwei Fälle pro Jahr, so Offizial Thorsten Weil damals im Interview mit dem Portal katholisch.de.
Zuvor habe das Erzbistum den Taufbucheintrag anhand der allgemeinen Regelungen für Kinder alleinerziehender Elternteile, unverheirateter Paare und den Regelungen der Bischofskonferenz für die Taufeintragungen von Adoptivkindern für den Einzelfall ausgewählt. "Was am ehesten passte – und den staatlichen Vorgaben entsprach", so Weil.
Das Vatikan-Schreiben vom vergangenen Oktober nennt als kirchenrechtliche Grundlage den Kanon 877 des allgemeinen Kirchenrechts. Darin werden mehrfach "Mutter", "Vater" und "Eltern" des Kindes genannt – wobei "Eltern", so das Schreiben, "in diesem Zusammenhang Vater und Mutter bedeutet". Die folgenden Ausführungen signalisieren Flexibilität und Rücksichtnahme auf nationale rechtliche Vorgaben.
Geändert wird nichts, allenfalls ergänzt
Für den Fall einer Geschlechtsänderung des Täuflings nach Hormonbehandlung oder chirurgischem Eingriff macht die Vatikanbehörde zwei Vorgaben: 1. Das Taufregister darf nicht geändert werden, indem der neue bürgerliche Name der Person eingetragen wird; 2. In den Kirchenbüchern muss vermerkt werden, "dass das beim Standesamt eingetragene oder erklärte Geschlecht nicht mehr mit dem bei der Taufe eingetragenen Geschlecht übereinstimmt".
In der Praxis trägt ein Pfarramt ins Taufregister jene Angaben ein, welche die Angehörigen machen. Dabei muss eine etwaige vor der Taufe erfolgte Geschlechtsänderung nicht genannt werden. Allgemein gilt: Geändert wird im Kirchenbuch nichts (außer offensichtliche Fehler), Ergänzungen allerdings sind möglich – und erscheinen unter Umständen auch in später von den Personen selbst oder bei Nicht-Volljährigen von Angehörigen erbetenen Auszügen aus Kirchenbüchern. Dabei sind staatliche Vorgaben zu achten, so etwa das Verbot, ein Adoptionsverhältnis offen zu legen.