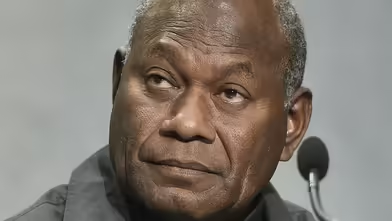Werden deutsche Städte wie Hamburg und Bremen in zehn bis fünfzehn Jahren untergegangen sein, versunken in Wassermassen? Was für manche wie ein Szenario aus einem Science-Fiction-Film klingen mag, halten viele Fachleute für wahrscheinlich - zumindest dann, wenn im Hochwasserschutz nicht viel geschieht. Ein Forschungsteam hat sich nun mit der Frage befasst, warum nicht nur in diesem Feld zu wenig gehandelt wird.
Einen entscheidenden Knackpunkt sehen sie in der Kommunikation rund ums Klima: Könnte die Auseinandersetzung mit möglichen Katastrophen stärker motivieren als die Suche nach Hoffnungszeichen? Am Samstag stellen sie ihre Ergebnisse vor - in Hannover dabei ist auch der bekannte Klimaforscher Mojib Latif.
Um Panikmache gehe es nicht, betont Gerriet Schwen, aus sozialwissenschaftlicher Perspektive federführend am Projekt "Klima, Kollaps, Kommunikation" beteiligt. Derzeit scheine es jedoch umgekehrt eine Art "höfliche Notwendigkeit" zu sein, dass etwa am Ende von Vorträgen betont werde, wo man Hoffnung sehe - egal, wie verstörend die vorgestellten Daten gewesen seien. "Dahinter steht wohl die Annahme, dass Menschen sonst ganz aufgeben."
Realität anerkennen - und anpacken
Allerdings habe die bisherige Form der Klimakommunikation "offensichtlich nicht ausgereicht", kritisiert Schwen. "Wir haben
seit mehreren Jahrzehnten sehr genaues Wissen darüber, wie schädlich Treibhausgase wirken. Dennoch steigen die Emissionen mehr oder weniger stetig an." Es werde aber kaum gesprochen, wofür es bereits zu spät sei oder welche Arten bereits ausgestorben seien. "Wenn man Menschen aber schockiert und berührt, könnten sie merken: wow, darum geht's, dann möchte ich mich noch viel mehr einsetzen."
Aus der Psychologie ist bekannt, dass Verdrängung langfristig eher Probleme schafft als löst - und dass Veränderung erst dann möglich wird, wenn man sich Schwierigkeiten stellt. Schwen überträgt dies auf den Umgang mit dem künftigem Klimachaos: "Wenn wir anerkennen, was ist, können wir realistische Handlungsspielräume ausloten und angemessene Strategien finden." Derzeit sei es jedoch allzu leicht, das Problem herunterzuspielen mit Sprüchen wir: "Wir hatten immer schon mal lange Sommer" oder "Es regnet halt grad viel".
Angst und Verlustgefühle gehören dazu
Dazu trügen auch falsche Vorstellungen von einem Klima-Kollaps im spektakulären Hollywood-Stil bei. Die Forschung betrachtet die Klimakrise dagegen als Prozess - nicht wenige sagen, dass die Menschheit längst mittendrin steckt.

Etwa in der Pazifik-Region, wo bereits ganze Inseln untergegangen sind, zeigt sich dies "viel direkter" als in Europa, sagte Kardinal John Ribat aus Papua-Neuguinea kürzlich im Gespräch mit DOMRADIO.DE: "Wir verlieren unsere Heimat."
Verluste zu betrauern und Ängste zuzulassen, halten auch die Fachleute aus Hannover für bedeutsam. Neben der Überlegung, wie ehrlich und konfrontativ die Auseinandersetzung mit der eigentlichen Thematik sein dürfe, habe man sich auch gefragt: "Wie emotional darf es sein? Wie viel Raum für Trauer braucht es? Und wie können wir Rituale schaffen - in einer Kultur, in der wir viele Rituale verloren haben?" Schwen sagt von sich selbst, durchaus Hoffnung zu haben - "aber nicht im Sinne eines faulen Optimismus".
Weniger "technisch-jargonhaft" sprechen
Allein die Sprache sei mitunter ein "Hindernis für eine offene gesellschaftliche Debatte und die notwendigen politischen und rechtlichen Regelungen", sagt der Sprachwissenschaftler Balint Forgacs. Begriffe wie "tödliche Klimazerstörung", "globale
Verbrennung" oder direktere Formulierungen wie "Hochofeneffekt" könnten die Risiken des Klimawandels deutlicher machen.
Auch schlägt der Neurolinguist vor, Begriffe aus der Medizin zu übernehmen - und etwa Kipppunkte bei einer klimatischen Entwicklung als "Metastasen" zu bezeichnen. Der Ausdruck meint ursprünglich Ableger eines krankhaften Geschehens, mit denen die Erkrankung - meist Krebs - einen anderen Körperteil erreicht. Bislang nutzten Fachleute oft eine "technisch-jargonhafte Sprache", die es für Menschen mit weniger Expertise erschwere, "die Auswirkungen der Klimakrise vollständig zu begreifen".
Mit "Wir-Gefühl" gegen drohende Erschöpfung
Zugleich brauche es mehr als Angst vor dem Klimawandel, sagt die Umweltpsychologin Paula Blumenschein. "Angst, Wut und Trauer sind zwar alles Klima-Emotionen, die einen Menschen motivieren. Darüber hinaus spielt aber auch das 'Wir'-Gefühl mit anderen, die sich für Klimaschutz einsetzen, eine Rolle - und die Überzeugung, dass man allein oder in der Gruppe etwas bewirken kann", betont die Autorin des Buchs "Klimabewegt". Wenn Menschen sich zu sehr verausgabten, drohe im schlimmsten Fall ein "activist burnout" - Rückzug wegen Erschöpfung.
Schwen sieht konkrete Ansatzpunkte: "Ich glaube zum Beispiel, dass es sich lohnt, einen Wasserfilter zu haben und Lebensmittelvorräte anzulegen - weil ich nur teilen kann, wenn ich etwas habe." Im Kern seien Menschen "hilfsbereite und soziale Wesen". Verbreitet seien jedoch viele negative Erwartungen. "Wenn ich davon ausgehe, dass mein Nachbar mir nur deshalb nicht mein Gemüse aus dem Garten klaut, weil wir uns nächste Woche auch noch verstehen müssen, dann ist es sehr beängstigend, darüber zu sprechen, dass Ressourcen künftig knapper werden könnten." Wer jedoch auf Zusammenhalt setze, könne die Erfahrung machen, "dass wir zumindest gemeinsam fallen, wenn die Welt, wie wir sie kennen, aus den Fugen fällt."