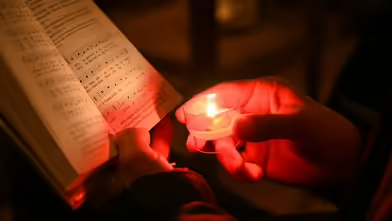Unschuldig Liturgie feiern und sich einfach inmitten der zum Gottesdienst versammelten Gemeinde tragen lassen, das funktioniert bei Alexander Saberschinsky meist nicht. Als Liturgiewissenschaftler habe er da eine professionelle Deformation, wie er es selbst nennt. "Es läuft immer im Hinterkopf ein Film mit. War das jetzt gut oder hätte man das vielleicht besser machen können?" – Der 56-Jährige ist seit 2006 Liturgiereferent des Erzbistums Köln und lehrt das Fach Liturgiewissenschaft an der Katholischen Hochschule NRW sowie an der Kölner Hochschule für Katholische Theologie.
Sein Interesse an Liturgie und Gottesdienst ist biografisch begründet. Direkt nach der Schule ist Alexander Saberschinsky, der aus Bad Ems an der Lahn stammt, in den Zisterzienserorden eingetreten und hat so einige Jahre als Mönch im Kloster verbracht. "Dadurch war zwangsläufig die Liturgie mehrfach am Tag über Jahre hinweg ganz zentral in meinem Lebensablauf platziert." Das Stundengebet und die tägliche Messfeier hätten ebenso dazugehört wie auch die verschiedenen liturgischen Dienste, die in der Ordensgemeinschaft reihum gingen. Später im Studium habe ihn der Übergang von der Liturgie zur Liturgiewissenschaft gereizt. Und so hatte Alexander Saberschinsky das Glück, später daraus auch seinen Beruf zu machen, der ihn über das Deutsche Liturgische Institut in Trier in das Erzbistum Köln führte.
"Liturgie ist ein originärer Ort, an dem sich Kirche ereignet", fasst der Liturgiereferent seinen Themenbereich zusammen und bedauert gleichzeitig, dass sich selbst innerhalb der Kirche zu wenige dafür interessieren. Gottesdienst sei nicht die Deko oder das Sahnehäubchen, was noch dazukomme, sondern eine Grundfunktion der Kirche neben der Verkündigung und dem gelebten Glauben, der Diakonia. "Weil hier ein ungehobenes Potenzial für die Frage der Kirchenentwicklung liegt, müsste die Liturgie in der Kirche viel mehr interessieren."
Die Frage der Qualität eines Gottesdienstes hänge davon ab, welchen Maßstab man anlege, so Saberschinsky. "In der Praxis legen die Leute einen unterschiedlichen Qualitätsbegriff an." Auch in der Betriebswirtschaft müsse um den Begriff 'Qualität' gerungen werden. "Ist Qualität eine Eigenschaft, die dem Produkt anhaftet oder ist Qualität etwas, das vom Kunden bestimmt wird?" Immer wenn dies einseitig aufgelöst werde, kommt es zu ganz bösen Verkürzungen, die Alexander Saberschinsky schon als 'Gefahren' bezeichnen möchte.
Qualitätsdreieck der Liturgie
Wenn es in der Liturgie in erster Linie darum gehe, die Lehre der Kirche korrekt darzustellen, dann sehe man Liturgie weniger als Feier, sondern als katechetische Unterweisung. Bei der einseitigen Betonung des Einhaltens des Ritus werde Liturgie hingegen zur Magie, die davon ausgeht, dass Gott handeln muss, weil das Ritual eingehalten wurde. Und wenn die Feiernden einseitig in den Blick genommen würden, dann laufe Liturgie Gefahr, zur reinen Bedürfnisbefriedigung zu werden. "Ein qualitätvoller Gottesdienst setzt genau diese drei Punkte in eine Beziehung zueinander und hält eventuelle Spannungen dazwischen aus", formuliert Alexander Saberschinsky ein Qualitätsdreieck der Liturgie.

Bei Fernsehgottesdiensten sei die Qualität immer wieder eine wichtige Frage, um die gerungen werde, berichtet der Liturgiereferent aus seiner Kooperation mit der Katholischen Fernseharbeit. Man müsse einerseits ganz andere Bilder einsetzen, um den Zuschauern, die nicht im selben Raum anwesend sind, ein innerliches Mitfeiern zu ermöglichen. Da genüge es nicht, aus derselben Perspektive auf den Altar zu schauen wie die Gläubigen, die vor Ort sind. Aber auch da gebe es einen Kipppunkt, so Saberschinsky. "In dem Augenblick, wo ich zu Hause den Eindruck habe, das ist ja nur alles Show, da ist es dann aufgesetzt."
Corona trieb auch Liturgieentwicklung voran
Tiefe Spuren hat die Corona-Pandemie auch in der Liturgie der Kirche hinterlassen. Alexander Saberschinsky erinnert sich an den ersten Lockdown vor fünf Jahren, vor dem sich nie jemand vorgestellt habe, dass öffentliche Gottesdienste nicht gefeiert werden können. Beeindruckend sei dann aber gewesen, was manche Gemeinden innerhalb kürzester Zeit an Übertragungen auf die Beine gestellt haben, auch wenn beispielsweise die Bildführung nicht professionell gewesen sei. "Denn meinen eigenen Pfarrer in der Kirche zu sehen, wohin ich nicht gehen darf, hat soviel von dem wettgemacht, was nicht professionell war."
Die Liturgiewissenschaft habe die Entwicklungen während der Corona-Pandemie schnell reflektiert, erklärt Saberschinsky. "Digital ist nicht virtuell", fasst der Liturgiereferent des Erzbistums seine Erfahrung zusammen. Vieles sei digitalisiert worden und habe so eine reale Mitfeier des liturgischen Geschehens ermöglicht. Diese Erfahrung kenne man allerdings bereits aus den Fernsehgottesdiensten. Was aber ist, wenn sich die Gemeinde ausschließlich digital trifft wie beispielsweise bei einer Videokonferenz? "Das ist für die Liturgie hochproblematisch, weil das schwer zu Ungunsten des Feiercharakters geht", wendet der Theologe ein.
Doch jeder, der einmal an einer Videokonferenz teilgenommen hat, sage hinterher ja auch nicht, das sei jetzt nichts gewesen, man habe sich nicht getroffen. "Das ist ja auch irgendwie eine Form von Vergemeinschaftung." Und eigentlich gehe das doch genau in die Richtung, wie sich das Stundengebet versteht. Die Hochform sei die, wenn man zur Tagzeitenliturgie wie beispielsweise zur Vesper in der Kirche zusammenkommt. "Aber gleichzeitig ist es auch theologisch völlig klar: Wenn ich allein im Zugabteil sitze und die Vesper bete, verbinde ich mich mit der Gebetsgemeinschaft der Kirche insgesamt, die überall auf der Welt irgendwo die Vesper betet."
Wort-Gottes-Feiern unter bestimmten Umständen
Im Erzbistum Köln hat Alexander Saberschinsky in den vergangenen knapp 20 Jahren die Erfahrung gemacht, dass die Katholiken im Rheinland auch nicht ganz anders ticken als die in den anderen deutschen Diözesen. Natürlich habe jede Region ihr eigenes Gepräge und in der weitläufigen Diaspora geschehe kirchliches Leben anders als in traditionell katholisch geprägten Ballungsräumen, die vor allem das Erzbistum Köln ausmachen. Letztendlich gelte für Köln dasselbe wie für alle Bistümer: Gläubige und Priester werden weniger, aber die Fläche bleibt dieselbe. Und da sei nun die Herausforderung, gelebten Glauben weiterhin sichtbar zu machen. Hier sieht Saberschinsky ein gutes Netzwerk von unterschiedlichen Gottesdienstangeboten innerhalb des Seelsorgeraumes als erstrebenswert.

Nach über 20 Jahren Diskussion habe man jetzt auch im Erzbistum Köln – unter ganz bestimmten Umständen – die Wort-Gottes-Feier am Sonntag. Voraussetzung dafür sei, dass eine Eucharistiefeier vor Ort nicht möglich ist und dass die Eucharistie aus einem anderen Gottesdienst überbracht wird, so dass man vor Ort nicht einfach die Reste vom letzten Gottesdienst kommuniziert. Außerdem sei das Personal, das solche Wort-Gottes-Feiern leitet, entsprechend geschult. "Ich dachte, jetzt rennen sie uns die Bude ein", erinnert sich der Liturgiereferent an diesen für das Erzbistum bedeutsamen Schritt. Tatsächlich gebe es auch eine gewisse Nachfrage bei den Ausbildungskursen.
Was hingegen völlig neu aufgeploppt sei, ist die Nachfrage nach Wort-Gottes-Feiern an Werktagen, wundert sich Saberschinsky. Das sei aber gerade im Erzbistum Köln schon seit langem völlig problemlos möglich und zuletzt noch 1999 von Kardinal Meisner bestätigt worden, der die Entscheidung darüber an die verantwortlichen Pfarrer delegiert hatte. "Das ist im Erzbistum Köln viel niederschwelliger als in anderen Diözesen", betont der Theologe und Liturgiereferent angesichts des Narrativs, dass Köln konservativ sei.
Kein Rückzug auf den "heiligen Rest"
Dass sich die Kirche gegenwärtig in einer radikalen Umbruchsphase befindet, sei auch in der Liturgie sehr deutlich zu merken. Wie man als Gemeinde oder Kreis von Gläubigen damit umgehen solle? Von einem Rückzug auf den "heiligen Rest" hält Alexander Saberschinsky nicht viel. "Natürlich kann man gerne Kerngruppen bilden, aber keine Kerngruppen, die sich vom 'laschen Rest' abschotten, sondern wir müssten stärker den Kontakt mit den Menschen suchen." Auf den Gottesdienst bezogen sieht der Liturgiewissenschaftler hier eine große Bedeutung der Kasualien, also der Gottesdienste, die anlässlich eines biografischen Anlasses gefeiert werden wie Taufen, Trauungen und Bestattungen.
Neben der sonntäglichen Eucharistiefeier müsse man diese Feiern, bei denen Menschen in bestimmten Lebenssituationen begleitet werden, stärker in den Blick nehmen, sagt Saberschinsky. "Es geht jetzt nicht darum, die Liturgie den Menschen anzupassen und die Botschaft zu verwässern. Es geht darum, das, was wir in der Liturgie feiern, nochmal neu aus der Perspektive der Lebenssituation der Menschen wahrzunehmen und das dann in diese Feier einzubringen." Die Kirche habe doch etwas dazu zu sagen, wenn beispielsweise ein Leben zu Ende geht.
Die Art und Weise unseres Betens soll dem entsprechen, was wir glauben, formuliert Alexander Saberschinsky den alten Grundsatz "lex orandi, lex credendi" und stimmt daher Kardinal Marx zu, der einmal in einer Predigt gesagt hat, dass man uns Christen daran erkennen solle, wie wir beten, Gott suchen und ihn bezeugen. "Deswegen sollte man auch in der Liturgie erkennen, wer wir sind, wie wir beten, woran wir glauben. Und das sollte so einladend sein, dass andere sagen: Das könnte sogar etwas für mich sein."
Buchtipp: Alexander Saberschinsky, Gott - Welt - Mensch, Gottesdienst feiern in heutiger Zeit (Andreas Redtenbacher [Hg.], Liturgie und Leben, Bd. 1), Regensburg 2024.