DOMRADIO.DE: Vor 40 Jahren wurde das Deutsche Liturgische Institut, welches "Liturgie im Fernkurs" anbietet, gegründet. Umfassend und zuverlässig über den katholischen Gottesdienst informieren, das Verständnis für die Liturgie vertiefen sowie Kenntnisse vermitteln - das hat sich das Institut auf die Fahne geschrieben. Jetzt wird das Institut 40 Jahre alt. Was macht den Kurs besonders und warum ist er bis heute relevant?
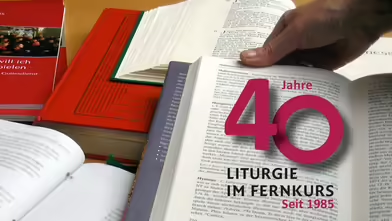
Iris Maria Blecker-Guczki (Leiterin von "Liturgie im Fernkurs" am Deutschen Liturgischen Institut): Besonders ist, dass es uns seit 40 Jahren gibt, das ist bemerkenswert. Außerdem sind wir meines Wissens nach der einzige Kurs, der sich nur mit Gottesdienst und Liturgie im Bereich der katholischen Kirche beschäftigt. Das tun wir relativ umfassend mit den zwölf Lehrbriefen, da wird kein Thema ausgelassen.
Relevant ist er, weil die Leute das bis heute immer noch interessiert: Was ist eigentlich Liturgie? Was passiert da? Wenn man selber aktiv in der Liturgie tätig ist, dann stellen sich noch viel mehr Fragen, die mit dem speziellen Dienst verbunden sind.
DOMRADIO.DE: Wie ist vor 40 Jahren die Idee entstanden, so etwas zu gründen?
Blecker-Guczki: Die Idee ist schon älter als 40 Jahre. Das war, als sich das Zweite Vatikanische Konzil in den 60er-Jahren auch schon mit Liturgie beschäftigt hatte. Die Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium ist in den 60er-Jahren herausgekommen als eine der ersten Konzilskonstitutionen überhaupt. Da gab es großen Reformbedarf.
Als man anfing, das umzusetzen, auch in den einzelnen Ländern und in die jeweiligen Volkssprachen, brauchte es Bildung. Zuerst für die Hauptamtlichen, für die Priester und Diakone, die hauptsächlich mit Liturgie befasst waren. Die mussten lernen, was neu ist und was es zu beachten gilt, wie es überhaupt volkssprachlich geht. Man muss bedenken, dass vorher alles auf Latein war.
Als diese erste Runde der Bildung der Hauptamtlichen durch war, hat man überlegt, wie es weitergeht. Man hat gesehen, dass es immer noch einen großen Bildungsbedarf im Bereich der Liturgien gibt, nicht nur bei den Hauptamtlichen, sondern auch bei den ehrenamtlich Engagierten. Sie hatten viele Fragen und wollten wissen, was da passiert, warum das passiert und wie das passiert. Deshalb hat man in den 80er Jahren einen Fernkurs konzipiert speziell für die Nichtstudierten, für die Laien in Gottesdiensten.
DOMRADIO.DE: Wer sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer?
Blecker-Guczki: Wir haben den Kurs damals in Zusammenarbeit mit "Theologie im Fernkurs" entwickelt . Das sind bis heute immer auch einige Studierende, die den "Theologie im Fernkurs" gemacht haben und dann sehen, dass man den Bereich Liturgie vertiefen kann in einem eigenen Kurs. Viele sind in liturgischen Diensten tätig, als Lektorin, Kantor, Kommunionhelferin, Beauftragter Wortgottesfeier-Leitung, Erstkommunionshelfer oder Religionspädagoginnen.
Sie merken, dass sie für ihren Dienst mehr wissen möchten, mehr Hintergrundwissen oder auch das eine oder andere geschichtliche Detail wissen wollen: Wo kommt das eigentlich her, warum ist das so und wie wird das angemessen vollzogen? Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die persönliche Fragen haben, sich fortbilden wollen und für ihr spirituelles Leben sehr profitieren.
DOMRADIO.DE: Wie ist der Kurs aufgebaut?
Blecker-Guczki: Wir haben zwölf Lehrbriefe plus einen Einführungsbrief, der ist vorgeschaltet, um zu erklären, wie der Kurs funktioniert und um was es inhaltlich geht. Die zwölf Lehrbriefe behandeln ganz unterschiedliche Themen, zum Beispiel Kirchenjahr, Brauchtum, Musik und Gesang, Kirchenraum. Das sind die ganzen praktischen Fragen.
Es gibt aber auch theoretischere Fragen zur Theologie der Liturgie, nicht ganz unwichtig, das zieht sich durch. Weitere Themen sind die verschiedenen liturgischen Dienste, Sprache und Kommunikation in der Liturgie, Taufe, Eucharistie und Wortgottesfeier, um nur einige Themen zu nennen.
DOMRADIO.DE: Gibt es Kooperationen mit den Bistümern?
Blecker-Guczki: Kooperationen gibt es mehrere. Für die Ausbildung relevant ist der Kurs nicht überall, in einigen Bistümern für die Diakone oder auch für angehende Gemeindereferentinnen und -referenten, die das auf dem zweiten Bildungsweg machen. Das ist unterschiedlich. Mit einigen Bistümern machen wir gemeinsam Studienwochenenden, wo wir mit Referenten kooperieren, die für uns tätig werden.
Es gibt Begleitkurse in einigen Bistümern, speziell zu "Liturgie im Fernkurs". In Augsburg läuft das schon viele Jahre sehr erfolgreich und in München auch schon eine ganze Weile. Andere Bistümer überlegen noch, ob und in welcher Form sie das machen können. Aber das ist richtig gut, weil dann die Studierenden miteinander in Austausch kommen können. Das ist sonst nicht gegeben, wenn jeder für sich zu Hause am Schreibtisch studiert.
DOMRADIO.DE: Es gibt immer weniger Priester und immer weniger Gemeindemitglieder. Wie groß ist der Bedarf an liturgischer Bildung in den Gemeinden? Setzt sich der schwindende Trend da fort, merken Sie das?
Blecker-Guczki: Das ist eine komplizierte Frage. Das Schwinden an hauptamtlichem Personal macht ein Verstärken der Ehrenamtlichen notwendig. Es gibt viele Ehrenamtliche, die sich engagieren wollen, die Andachten oder Wortgottesfeiern leiten, Tauf- oder Erstkommunionskatechese machen, kleinere Impulse in Schulen oder Kindergärten geben. Überall kann man Liturgie feiern, es muss nicht immer die Messe sein.
Da gibt es großen Bedarf, gerade weil nicht mehr viele Hauptamtliche vor Ort sind. Auf der anderen Seite sind nicht mehr viele Feiernde in den Gottesdiensten. Das sehen wir seit der Covid-Pandemie sehr stark. Insofern muss man abwarten, wie die Entwicklung abläuft. Aber eigentlich sehen wir Bedarf an Bildung, gerade bei den Ehrenamtlichen.
DOMRADIO.DE: Welche Rolle spielt Liturgie für die Kirche von heute und wie kann der Kurs helfen, diese Liturgien lebendig zu halten?
Blecker-Guczki: Zum einen ist Liturgie etwas sehr Persönliches. Jeder geht für sich in den Gottesdienst, nimmt etwas mit oder auch nicht. Das ist eine sehr persönliche Sache, wie man Gottesdienste feiert, wie man dabei ist, ob man ein Gemeinschaftsmensch ist und das Feiern toll findet. Manchmal sind Lebensphasen so, dass man in sich gekehrt ist und für sich im Gebet Zwiesprache hält mit Gott. Letztlich geht es um Gotteserfahrung, individuell, aber auch gemeinschaftlich. Liturgie ist immer gemeinschaftliches Tun.
Da kommt der zweite Aspekt, der wichtig ist. Liturgie ist wichtig dafür, dass Kirche überhaupt da ist. Wenn die Kirche aufhört, Liturgie zu feiern, Eucharistie zu feiern, dann ist sie keine Kirche mehr. Es gehört zu den Basics des Kirche-Seins, miteinander Eucharistie zu feiern aufgrund des Stiftungsauftrags, den Jesus selbst seinen Jüngern gegeben hat.
Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Immer, wenn wir uns versammeln, ist er da. Wir halten ihn lebendig unter uns durch das Feiern der Liturgie. Mit Hinblick auf die Eucharistie geht es darum, Anteil zu haben an seiner Hingabe, Anteil am gebrochenen Brot und an dem einen Becher Wein. Wenn wir damit aufhören, dann wird es schwierig, noch Kirche zu sein.
DOMRADIO.DE: Blicken wir in die Zukunft, 40 Jahre weiter. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Blecker-Guczki: Natürlich wünsche ich mir, dass es uns weiterhin gibt. Außerdem wünsche mir, dass es ein stärkeres Bewusstsein bei den Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen für die Bedeutung der Liturgie gibt. Das sehe ich nicht überall. Bei der Qualität der Feiergestalt von Liturgien gibt es große Unterschiede, da ist immer Luft nach oben, wie man es gestaltet, wie man dadurch Menschen stärker ansprechen und einbeziehen kann.
Das wünsche ich mir sehr und es wäre schön, wenn die Bistümer noch stärker kooperieren würden. Denn ich sehe die schwindenden Ressourcen in den Bistümern, was Bildung und die Begleitung von Ehrenamtlichen angeht. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir noch stärker zusammenarbeiten könnten.
Das Interview führte Oliver Kelch.
Informationen zu "Liturgie im Fernkurs" finden Sie hier:
https://dli.institute/wp/thema-lif/erfahrungen/








