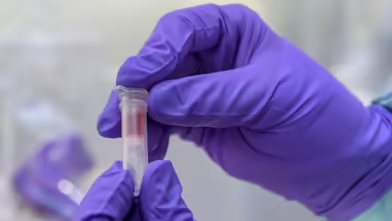Krankheiten gezielter bekämpfen, sie gar vorzeitig abwehren, zumindest als Service für Reiche? Oder eine totale Erfassung und Überwachung des Menschen, eingeteilt in organisch gute oder fehlerhafte Exemplare? Die Perspektiven, die sich mit dem Stichwort "personalisierte Medizin" bieten, sind zahlreich, komplex und größtenteils noch Zukunftsmusik.
Um Orientierung in diesen Dschungel zu bringen, hatte die Päpstliche Akademie der Wissenschaften gut 20 Wissenschaftler für zwei Tage in die Vatikanischen Gärten geladen.
"Personalisierte Medizin" im Wandel
Selten sei eine Veranstaltung zu dem Thema derart multidisziplinär besetzt gewesen wie am Sitz der Akademie, der ehrwürdigen Casina Pio IV., so der Eindruck der Wiener Politikwissenschaftlerin Barbara Prainsack.
Ein Problem der Diskussionen: Der vor 20 Jahren geprägte Begriff "personalisierte Medizin" wird heute unterschiedlich verstanden. Ein gemeinsamer Nenner lautet, gemeint sind Medikamente und Therapien, die das Genom der Patienten berücksichtigen, deren Genmarker. Teilweise geschieht dies schon bei einzelnen Krebsarten.
Natürlich sei Medizin immer persönlich gewesen, indem sich ein Arzt dem Patienten zuwandte, so Prainsack. Seitdem in den 1990er Jahren das menschliche Genom entschlüsselt wurde und die aufstrebende Gentechnik mit zunehmenden Möglichkeiten der Digitalisierung kombiniert wird, ergeben sich jedoch neue Möglichkeiten.
Medikamente wirken verschieden
Ein Grundproblem bisheriger Diagnosen und Therapien mittels Standardmedikation lautet: Krankheiten verlaufen bei Patienten selten gleich. Die einen reagieren sehr gut auf ein Medikament, andere nur wenig, dritte gar nicht, während eine vierte Gruppe heftige unerwünschte Nebenwirkungen zeigt.
Krankheiten haben viele Ursachen und Bedingungen. Was kein Wunder ist, da es etwa bei 20.000 Genprodukten mit 20.000 verschiedenen Molekülen im menschlichen Körper 400 Millionen mögliche Interaktionen gibt.
Die neue Medizin soll persönlicher und präziser sein, besser vorbeugen können und den Patienten stärker einbeziehen - so die hoffnungsvolle Aussicht. Laut Prainsack könnte dies jedoch dazu führen, dass ein Patient - versehen mit Unmengen an Daten über seinen Körper und seinen Lebenswandel - selber entscheiden muss. Zu ihm und seinem Hausarzt gesellt sich zunehmend "Dr. Google".
Datenfixierte Medizin
"Die medizinische Praxis wird datenfixiert", warnt Prainsack. In den möglichen Datenbestand eines Patienten fließen nicht nur Gewicht, Körpergröße und sein Genom ein, sondern auch Daten eines Fitnessarmbands, Wohn- und Aufenthaltsorte, Ernährungsgewohnheiten und vieles mehr. "Es ist dann so etwas wie ein 'digitaler Zwilling' des Menschen möglich", sagt Prainsack. Leisten können sich das bisher allenfalls Reiche.
Der israelische Arzt Yechiel Michael Barilan sieht gar das Risiko, dass einzelne Menschen ausgestoßen werden, weil sie bestimmte genetische Merkmale haben, die mit einem hohen Krankheitsrisiko oder Therapieresistenz verbunden werden.
Und Aaron Chiechanover, Chemie-Nobelpreisträger aus Israel, warnt vor einem Ende bisheriger Pharmaforschung. Wenn Medikamente und Therapien immer individueller ausfallen, würde entsprechende Forschung teurer und unrentabler, weil weniger Standardmedikamente gefragt sind.
Was macht menschliches Leben aus?
Zudem, fragt Chiechanover weiter, was, wenn bei genetischen Analysen von Blut oder Gewebe Risikofaktoren offenbar werden, von denen der Patient nichts ahnte und in deren Diagnose er nicht einwilligte? Das Problem des Datenschutzes würde sich in der neuen Medizin-Welt vervielfachen.
Politikwissenschaftlerin Prainsack schätzt am Tagungsort und Veranstalter Vatikan, dass dort Fragen nach Gerechtigkeit, Ethik und Regulation stärker gestellt werden als bei anderen Konferenzen - etwa: Was macht menschliches Leben aus? Was gibt ihm Sinn? Hängt subjektives Glück von objektiven Daten ab? Stecken wir Geld in medizinische Forschung, die einigen Privilegierten zugute kommt oder in eine gesündere Infrastruktur für viele? "All das muss dringend besprochen werden", so Prainsack.
Für eine erste Runde sei der formelle und steife Rahmen, den die Päpstliche Akademie vorgibt, ganz gut. Auch der Umgangston falle dort höflicher aus als andernorts. Für weitere Austauschrunden indes würde die Wissenschaftlerin flexibel-kreative Workshops bevorzugen.