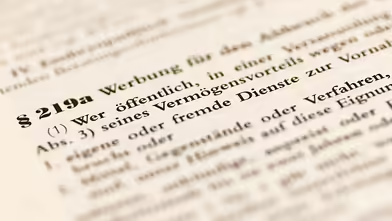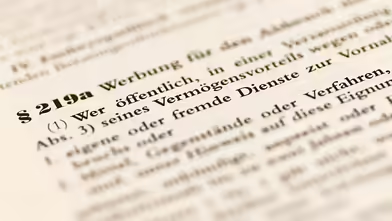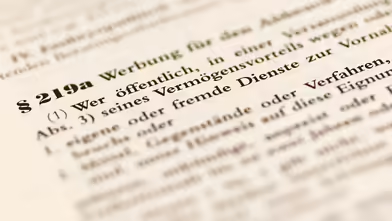Monatelang hatten die Unions- und SPD-Minister gerungen. Am Ende scheint ein Kompromiss herausgekommen zu sein, mit dem der Großteil der Beteiligten leben kann: Es geht um den Paragrafen 219a, das Werbeverbot für Abtreibungen. Die Union wollte ihn belassen, die SPD zunächst streichen. Der Kompromiss sieht nun eine Ergänzung des Paragrafen vor, um Schwangeren einen besseren Zugang zu Ärzten zu geben, die eine Abtreibung durchführen. Zugleich sollen diese Ärzte eine größere Rechtssicherheit erhalten.
SPD und Union haben unterschiedlich Ansichten zu 219a
An diesem Mittwoch will das Kabinett den Gesetzentwurf auf den Weg bringen. Geht man von den Reaktionen in der vergangenen Woche aus, scheint der Großteil von Union und SPD zufrieden. Die Situation war über Monate verfahren: Die SPD wollte den Paragrafen 219a eigentlich abschaffen, zog aber einen entsprechenden Entwurf im Frühjahr 2018 zurück, um den Koalitionsfrieden zu wahren.
Die Union bestand darauf, den Paragrafen zu lassen, wie er ist. Der Passus untersagt das Anbieten, Ankündigen oder Anpreisen von Schwangerschaftsabbrüchen aus finanziellem Vorteil heraus oder wenn dies in grob anstößiger Weise geschieht. Zudem soll eine Abtreibung nicht als normale Dienstleistung gelten, die Ärzte in ihrem Leistungsangebot aufführen können.
Fünf Minister suchten einen Kompromiss
Auslöser für die Debatte war insbesondere ein Gerichtsurteil. Das Amtsgericht Gießen verurteilte Ende 2017 die Ärztin Kristina Hänel wegen unerlaubter Werbung für Schwangerschaftsabbrüche zu einer Geldstrafe. Abtreibungsgegner hatten auf ihrer Homepage entdeckt, dass sie Abbrüche anbietet, und Hänel angezeigt. Inzwischen laufen auch gegen andere Ärzte Verfahren.
An der Suche nach einem Kompromiss waren fünf Minister beteiligt: Neben Justizministerin Katarina Barley und Familienministerin Franziska Giffey (beide SPD) waren es Innenminister Horst Seehofer (CSU), Gesundheitsminister Jens Spahn und Kanzleramtschef Helge Braun (beide CDU). Eckpunkte hatten sie bereits vor Weihnachten vorgelegt.
Viele Ärzte haben Angst, sich strafbar zu machen
Konkret sieht die Einigung vor, dass Ärzte und Krankenhäuser etwa auf ihrer Internetseite darüber informieren dürfen, dass sie Abtreibungen unter den gesetzlichen Voraussetzungen durchführen. Zudem soll die Bundesärztekammer verpflichtet werden, eine Liste der Ärzte und Krankenhäuser zu führen, die Abbrüche durchführen. Diese soll auch die Möglichkeiten und Methoden aufzählen und ständig aktualisiert werden. Werbung für Abtreibung bleibt weiter strafbar.
Das Bundesgesundheitsministerium soll zudem bis Jahresende Vorschläge vorlegen, wie die Methoden für einen Abbruch weiterentwickelt und ausgeweitet werden können. Befürworter einer Abschaffung des Paragrafen betonten stets, dass es in einigen Regionen in Deutschland kaum noch Ärzte gebe, die Abtreibungen durchführen, weil sie Angst hätten, sich strafbar zu machen.
Linke, Grüne und FDP wollen weiterhin Streichung des Verbots
Ein weiteres Zugeständnis an die SPD: Frauen sollen künftig bis zum Alter von 22 Jahren einen Anspruch auf kostenfreie Versorgung mit verschreibungspflichtigen empfängnisverhütenden Mitteln ("Pille") haben. Teil des Kompromisses war auch, dass das Gesundheitsministerium noch in diesem Jahr eine Studie in Auftrag geben will, die die seelischen Folgen einer Abtreibung für Frauen untersuchen soll. Die SPD ist mehrheitlich gegen dieses Vorhaben, das nicht im Gesetzentwurf enthalten ist.
Erwartungsgemäß kritisierte die Opposition die geplante Reform: Linke, Grüne und FDP fordern weiter die komplette Streichung des Werbeverbots für Abtreibungen. Bei den Grünen fiel die Kritik aber vergleichsweise verhalten aus.
Sachliche Information ja, plakative Anpreisung nein
Unterschiedliche Reaktionen gab es innerhalb der katholischen Kirche: Während die Deutsche Bischofskonferenz erklärte, die Reform sei überflüssig, weil es bereits jetzt ausreichend Informationen gebe, sprach das Zentralkomitee der deutschen Katholiken von einem tragfähigen Kompromiss. Zufrieden äußerte sich auch die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD).
Die Bundesärztekammer begrüßte den Entwurf ebenfalls. "Werbung im Sinne von plakativer Anpreisung darf es für ärztliche Leistungen nie geben", sagte deren Präsident Ulrich Montgomery. "Aber sachliche Informationen über entsprechend legitimierte Quellen müssen möglich sein."