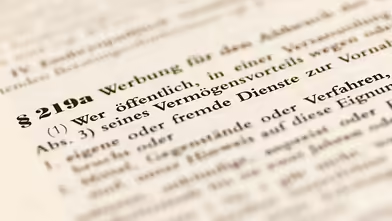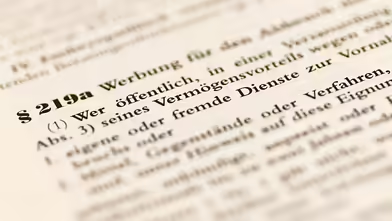Mit einem Kompromiss hatten Union und SPD zu Jahresbeginn gehofft, die Debatte über das Werbeverbot für Abtreibungen zu beenden. Der Paragraf lässt die Politik aber nicht zur Ruhe kommen: Im Juni wurden zwei Ärztinnen aus Berlin nach der Reform verurteilt. Am Mittwoch hob das Oberlandesgericht Frankfurt das Urteil gegen die Ärztin Kristina Hänel auf, die inzwischen zu einer Galionsfigur für die Bewegung geworden ist, die den Paragrafen ganz abschaffen will.
Es geht um den Paragrafen 219a im Strafgesetzbuch. Dieser untersagt das Anbieten, Ankündigen oder Anpreisen von Schwangerschaftsabbrüchen aus finanziellem Vorteil heraus oder wenn dies in grob anstößiger Weise geschieht. Damit soll nicht zuletzt gewährleistet werden, dass Abtreibung nicht wie eine ganz normale andere Dienstleistung angesehen wird.
Auf eine Reform des Paragrafen 219a geeinigt
Nach monatelangen heftigen Auseinandersetzungen hatten sich Union und SPD zu Jahresbeginn auf eine Reform geeinigt: Der Paragraf wurde gelockert, aber eben nicht abgeschafft, wie es große Teile der SPD sowie die Oppositionsfraktionen mit Ausnahme der AfD wollten.
Der unter der Federführung des SPD-geführten Justizministeriums erzielte Kompromiss sieht vor, dass Ärzte und Krankenhäuser etwa auf ihrer Internetseite darüber informieren dürfen, dass sie Abtreibungen unter den gesetzlichen Voraussetzungen durchführen; sie dürfen aber nicht die Methoden angeben. Zudem obliegt es danach künftig der Bundesärztekammer, eine Liste der Ärzte und Krankenhäuser zu führen, die einen Abbruch vornehmen. Diese soll auch die Möglichkeiten und Methoden aufzählen und ständig aktualisiert werden. Werbung für Abtreibung bleibt weiter strafbar.
Bischofskonferenz hält Reform für überflüssig
Unterschiedliche Reaktionen auf den Kompromiss gab es innerhalb der katholischen Kirche: Während die Deutsche Bischofskonferenz erklärte, die Reform sei überflüssig, weil es bereits jetzt ausreichend Informationen gebe, sprach das Zentralkomitee der deutschen Katholiken von einem tragfähigen Kompromiss. Zufrieden äußerte sich auch die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD).
Auslöser für die Debatte über den Paragrafen war der Fall Hänel: Das Amtsgericht Gießen hatte sie Ende 2017 wegen des Verstoßes gegen Paragraf 219a zu einer Geldstrafe verurteilt. Abtreibungsgegner hatten entdeckt, dass sie auf ihrer Homepage Abbrüche anbietet, und Hänel angezeigt.
Das Landgericht Gießen verwarf ihre Berufung. Hänel legte daraufhin Revision zum Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) ein. Nach der Reform des Paragrafen hob das Gericht nun das Urteil auf. Begründung: Es lasse sich nicht ausschließen, dass das neue Recht zu einer für die Angeklagte günstigeren Bewertung führe.
Landgericht muss erneut entscheiden
Nun muss das Landgericht Gießen erneut über den Fall entscheiden. In einer ersten Reaktion erklärte die rechtspolitische Sprecherin der Union, Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU), die Neuregelung sei tragfähig. In der ganzen Diskussion dürfe nicht vergessen werden, dass der Hauptkonflikt zwischen Mutter und Kind bestehe.
Hänel selbst geht davon aus, dass sie sich mit den auf ihrer Homepage angegebenen Informationen über Abtreibungen weiterhin strafbar macht, so schreibt sie via Twitter. Und fügt ein "Leider" hinzu. Sie will, so hat sie mehrfach angekündigt, notfalls bis zum Bundesverfassungsgericht gehen.