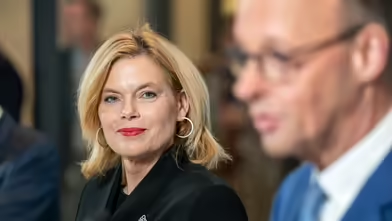DOMRADIO.DE: Sie sind seit mehr als 20 Jahren Parlamentarierin. Was ist in den letzten zwei Wochen für Sie persönlich anders als zuvor?
Julia Klöckner (CDU-Politikerin und Bundestagspräsidentin): In den 20 Jahren war jedes Jahr anders, aufgrund der politischen Begebenheiten und Umstände sowie aufgrund meiner unterschiedlichen Funktionen, sei es als Regierungsmitglied oder als Sprecherin für die Wirtschaftsarbeitsgruppe. Jetzt ist es etwas sehr Besonderes, an der Spitze von 2.200 Mitarbeitern der Bundestagsverwaltung zu stehen und das ganze Parlament im Blick zu haben.
Ich arbeite mich in die neuen Aufgaben ein und organisiere die Präsidiumssitzungen. Wir planen den 8. Mai zum Beispiel als Gedenkveranstaltung zu 80 Jahren Kriegsende. Meine Arbeit hat sich durch die Verdichtung und die Rolle verändert.
DOMRADIO.DE: Die Rolle, die Sie jetzt übernehmen, ist eine unparteiisch-neutrale Position. Wie können Sie neutral bleiben, wenn es Abgeordnete im Bundestag gibt, denen es darum geht, diesen zu delegitimieren?
Klöckner: Erstmal zeige ich niemandem die kalte Schulter, sondern sage sehr klar, dass ich für das gesamte Hohe Haus zuständig bin. Zum gesamten Hohen Haus gehören erstmal alle Abgeordnete, die legitim Mitglieder dieses Hauses sind. Jeder bekommt das gleiche Abgeordnetengehalt, da gibt es keine zwei Klassen.
Am Ende gibt jeder Zeugnis durch sein Handeln, durch sein Sagen und das, was er an Denkweisen mitbringt. Das wird sich dann zeigen. Ich habe in meiner Antrittsrede klar gemacht, dass ich großen Wert darauf legen werde, dass wir in diesem Parlament zivilisiert miteinander umgehen. Ich werde nicht die "Obernanny" der Nation sein, die freie Rede ist wichtig. Einen Diskursrahmen im Rahmen der Verfassung muss man aushalten.
Demokratie ist auch eine Zumutung, aber wir kämpfen um die besseren Argumente mit Worten, nicht mit irgendwelchen Zeichen und Symbolen. Darauf wird geachtet. Andererseits muss der Ton stimmen. Ansonsten gibt es Ordnungsrufe und sonstige Maßnahmen. Das gilt für alle Abgeordnete.
DOMRADIO.DE: Demokratie ist auch Zumutung, sagen Sie. Es gibt Menschen in Deutschland, die vielleicht keine Lust mehr auf solch eine Zumutung haben. Wie treten Sie diesen in einer christlichen Perspektive gegenüber?
Klöckner: Sie sprechen eine zentrale Herausforderung unseres Landes an. Es bedarf der Überzeugung, dass die Demokratie das beste System ist. Es ist zugegebenermaßen nicht immer das effizienteste, das effektivste und schnellste. Aber Demokratie verhindert das Schlimmste, nämlich autokratische, diktatorische Züge.
Die Demokratie hat Mehrheiten, aber auch Minderheiten im Blick. Demokratie hat sich seit ihrer Existenz immer wieder in den Ausdrucksformen verändert. Das heißt, dass wir heute zum Beispiel in die sogenannte "Digitale Theke" gehen müssen, wo wir Menschen erreichen, die wir anders nicht erreichen, um zu erklären und zu erläutern. Wie erreichen wir Menschen, die an der Demokratie zweifeln? Wir müssen erklären, transparent sein und Alternativen aufzeigen, was Abwesenheit von Demokratie bedeuten würde. Wir müssen auch zum Vergleich den Blick in die Welt wagen.
Deutschland ist trotz allem Druck und trotz wirtschaftlicher Schwäche, ein sehr attraktives Land wo viele Menschen hinwollen. Und das nicht, weil wir es nicht gebacken kriegen, sondern weil es so attraktiv ist. Unsere Aufgabe ist es, dieses Land zu stabilisieren, damit wir stark bleiben. Menschen sollen aber auch wissen, dass Demokratie nicht im Schlafwagen zu haben ist.
DOMRADIO.DE: Zur Stabilität gehört Vertrauen. Vor der Wahl hat ihre Partei, die CDU, fast schon dogmatisch an der Schuldenbremse festgehalten. Jetzt gibt es Milliardenschulden. Macht das nicht den Vertrauensverlust viel größer bei den Menschen?
Klöckner: Ich will mich nicht parteipolitisch äußern. Sie haben vorhin meine Neutralität angesprochen. Ich will aber sehr deutlich machen, dass es einen Unterschied gibt: Ob man die Schleusen öffnet und nicht definiert, für was man Investitionen braucht oder ob man sehr klar definiert, dass es um die Innere Sicherheit, die veränderte geostrategische Lage und eine Infrastrukturnotwendigkeit geht. Über eine unsichere Brücke will keiner von uns fahren.

Auf der anderen Seite werden wir alle einsparen müssen. Wir werden mit dem Geld, das da ist, haushalten müssen. Sie sprechen das Thema Vertrauen an: Es gibt keinen Menschen, der fehlerfrei ist, und es gibt keine statische Situation. Wir können nicht voraussehen, wie es in zwei oder vier Jahren sein wird. Wichtig ist, dass wir Menschen akzeptieren, dass wir begrenzt sind.
Zum anderen müssen wir unser Bestes geben. Und als Politiker ist es unsere Aufgabe, mit den Leuten zu sprechen. Ich lege immer großen Wert darauf, so zu sprechen, dass man uns versteht, dass wir transparent sind und dass wir erklären. Auch wenn man etwas korrigiert, zum Beispiel einen eingeschlagenen Weg bei der Energie- oder Migrationspolitik, muss man erklären, warum und die Leute mitnehmen. Das ist unser Job, dafür werden wir bezahlt. Am Ende entscheiden dann Mehrheiten.
Ich glaube, die Persönlichkeiten sind wichtig in der Politik: Dass wir keine Roboter sind, dass wir auch um Argumente ringen und am Ende wissen, dass wir immer nur die vorletzten Antworten geben können.
DOMRADIO.DE: Sie sind selbst bekennende Katholikin, sparen aber auch nicht mit Kritik an der Kirche. Der Einfluss der Kirchen wird in der Gesellschaft immer geringer, zumindest scheint es so. Welche Bedeutung hat eine kirchliche Stimme im Bundestag noch?
Klöckner: Das frage ich mich auch manchmal. Ich bin kirchlich sozialisiert, war lange Lektorin, habe in der Schola gesungen, zahle meine Kirchensteuer und war lange im Zentralkomitee der Katholiken. Ich halte es zum einen für nicht immer sinnvoll, wenn Kirchen glauben, eine weitere NGO zu sein und sich zu Tagespolitik äußern. Man kann für Tempo 130 sein, aber ich weiß nicht, ob die Kirchen dazu etwas schreiben müssen.
Mein Kritikpunkt ist häufig aus innerer Verbundenheit gewachsen. Zum Beispiel in der Corona-Zeit, wo viele Menschen nicht nur auf der Sinnsuche, sondern allein und verzweifelt waren. Da hätte Seelsorge stärker präsent sein können. Zweitens haben wir Fragen, die bioethischer Natur sind, die Anfang und Ende des Lebens betreffen. Da wünsche ich mir von meiner Kirche, dass sie standhaft ist und nicht automatisch schaut, ob es Applaus gibt oder nicht.
Wenn es um das ungeborene Leben geht oder das Leben, das den letzten Atemzug macht, also um die Fragen, was der Mensch darf oder was er nicht darf, dann sind das Punkte, wo unsere Kirche auch mit Blick auf Bewahrung der Schöpfung durchaus die Stimme erheben kann und auch sollte. Solange man noch einen kritischen Punkt hat – wie umgekehrt die Kirche ja auch an der Politik – hat man auch Interesse aneinander.
DOMRADIO.DE: Der Bundestag ist aktuell so männlich wie seit Jahren nicht mehr. Am Tag Ihrer Wahl haben Sie von Vorbildern gesprochen. Was für ein Vorbild wollen Sie in den nächsten vier Jahren vor allem auch für junge Frauen in diesem Land sein?
Klöckner: Dass ich meine Aufgabe so erfüllt habe, dass sie dem Amt und der Würde gerecht geworden ist. Es ist das zweithöchste Staatsamt in unserem Land und ich verstehe mich als eine der Hüterinnen unserer Demokratie. Unsere Bundestagsverwaltung ist dazu aufgerufen, Demokratie möglich zu machen. Demokratie muss organisiert und transportiert werden.
Der zweite Punkt ist, dass ich sehe, dass sich gar nicht viele Mädchen oder Frauen durch frauenpolitische Papiere angesprochen fühlen, sondern durch das Sein. Dadurch, dass Frauen in Ämtern sind. Das merke ich jetzt schon, dass sich viele junge Frauen bei mir zum Beispiel für Praktika bewerben. Ich sage: Mensch, Mädels, traut euch.
Aber auch die Jungs: Geht durch eine Tür, wenn sie offen ist, mutet euch etwas zu, werft nicht sofort die Flinte ins Korn und nutzt eure Talente. Talente sind da, damit sie genutzt werden und nicht brach liegen. Wenn ich das vermitteln kann, bin ich sehr froh.
Das Interview führte Moritz Mayer.