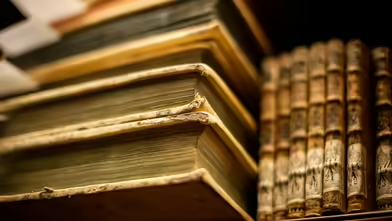Welche Bedeutung haben die Todsünden heute? Als geflügeltes Wort sagt man das eher leichthin: "Das ist eine Todsünde", doch glaubt kaum noch jemand, dass dann eine ernstzunehmende Bestrafung folgt. Im Mittelalter war das anders, Höllenstrafen drohten, wenn man die sieben Todsünden nicht beachtete.
Die Historikerin Annette Kehnel hat die sieben Todsünden unter das Mikroskop gelegt und entdeckt, dass in dem Konzept hinter den Todsünden eine erstaunliche Aktualität steckt. "Das in der Todsündenlehre gespeicherte Erfahrungswissen zeigt uns, wie wir unseren destruktiven Kräften entgegenwirken und unser positives, weltveränderndes Potential entfalten können", schreibt sie in ihrem Buch über die sieben Todsünden, die, so Kehnel, ein enormes Menschheitswissen für das Zeitalter der Krise gespeichert haben.
Für die Wissenschaftlerin überliefern die Riten der Religionen kulturelle Muster, von denen wir heute viel lernen können. Die Todsünden stehen dabei für das Maßhalten, für die sinnvolle Begrenzung menschlichen Handelns. Hochmut, Habgier, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid und Trägheit sind Verfehlungen, die den einzelnen Menschen und die Welt aus der Bahn werfen können.
Die Historikerin erklärt, dass die Todsünden als Regulierungs- und Drosselungskonzept viel älter als das Christentum sind: "Zum Beispiel gab es gegen die Völlerei Fastenzeiten in fast allen Kulturen und Religionen," erklärt sie im DOMRADIO.DE Interview. Bevor sie in den Sender am Kölner Dom gekommen sei, sei sie durch die Kölner Fußgängerzone gegangen. "Wenn sie die Unzahl der Pommesbuden und Süßigkeitenläden dort sehen, wird ihnen bewusst, wie aktuell das Konzept der Todsünde Völlerei ist – aus Gründen der Gesundheit aber auch aus Gründen der Nachhaltigkeit zur Bewahrung unserer Natur".
Spannend ist, wie Kehnel erläutert, dass die Aufklärung aus dem Laster der Habgier eine Tugend gemacht hat, die heute zu den Exzessen des Kapitalismus führt. Der Konsum wurde idealisiert und identitätsbestimmend. Und auf einmal galt es als besonders wertvoll, besonders viel zu besitzen. "Vorher war das eine Todsünde", erklärt Kehnel.
Der Hochmut als unbegrenzte Selbstüberschätzung sei eine weitere Todsünde von brennender Aktualität. Daraus resultiere eine enorme Selbstzerstörung, denn wenn ein einzelner Mensch zu viel Macht habe, drohe er überzuschnappen, sagt Kehnel. "Mechanismen zur Begrenzung von Macht gehörten immer zu den Handwerkszeugen von Kulturen". Dabei habe man die Erinnerung an die Demut rituell institutionalisiert. "Die Medizin gegen Superbia, Hochmut ist die Humilitas, die Demut", sagt Kehnel. Sie beschreibt Einsetzungsrituale von Herrschern, wie zum Beispiel der Herzog von Kärnten vor seiner Inthronisation von einem Bauern verhört wird.
"Viel kulturelles Wissen, was Nachhaltigkeit und langfristige Resilienz einer Gesellschaft betrifft, ist in religiöser Sprache verpackt", sagt Professorin Kehnel, "aber religiöse Sprache ist in unserer säkularen Welt vorbelastet". Die Überführung des Wissens in nichtreligiöse Sprache sei eine große Herausforderung. Die Kirche könne da auch Vorreiter sein.
Die Todsünden speichern ein enormes Wissen des Westens. Dieses Wissen kann das Überleben einer Gesellschaft sichern. Das ist die Quintessenz aus Kehnels erhellender Studie über die Todsünden. Sie ermahnen zur Begrenzung, zur Mäßigung. Dieses kulturelle Erfahrungswissen kann uns heute helfen, wachsam mit uns und mit unserer Natur umzugehen. Die Historikern Kehnel entdeckt die sieben Todsünden als eine Schatztruhe vergangener Lebensweisheiten und ein kostbares Menschheitswissen für unser Zeitalter der Krise.