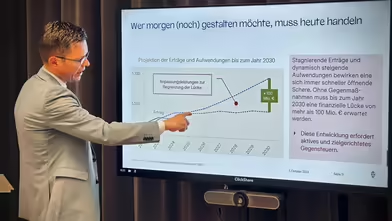DOMRADIO.DE: Immer mehr Ehrenamtler zeigen sich angesichts der Anstrengungen, die sie gerade in ihren Gremien zu stemmen haben, überfordert und ermüdet oder aber sie verabschieden sich aus ihrem langjährigen Dienst. Was wäre nötig, damit die Gläubigen solche Veränderungen mittragen und diese fruchtbar werden können?

Pfarrer Dr. Axel Hammes (Subsidiar in Bensberg/Moitzfeld und Geistlicher Berater der Thomas-Morus-Akademie): In der Kirche Gottes hat sich ein gewisser Materialismus breit gemacht. Strukturen, Finanzen, rechtliche Fragen genießen absolute Priorität. Doch dies alles hat sich an den Erfordernissen der Pastoral zu orientieren. Nicht umgekehrt darf sich an der Struktur entscheiden, was und wie wir uns pastoral engagieren. Die Frage, wofür wir als Kirche in dieser Zeit und Gesellschaft eigentlich stehen wollen, bleibt unterbelichtet.
Was die besondere Aufgabe der Kirche ist, kann nur ein umfassender geistlicher Prozess klären. Strukturveränderungen und dieser Prozess müssten sich gegenseitig durchdringen. Es genügt auch nicht, dem Ganzen nur ein paar geistliche Übungen vorauszuschicken, um die spirituelle Dimension pflichtschuldig abzuarbeiten und dann zur administrativen Tagesordnung überzugehen. Solche tiefgreifenden, vom Bistum angestoßenen Wege sollten in einem ständigen Austausch stehen. Einen Rahmen dafür muss es natürlich geben, nur darf der nicht zu eng abgesteckt sein.
Wir überlegen vielmehr die sachlichen Notwendigkeiten, aber wir fragen auch, ob sie wirklich dienen und zwar dem, was wir als unseren Auftrag vom Evangelium, von der Überlieferung des Glaubens, von dem, was die Kirche ausmacht, erkannt haben. Das aber geschieht nicht nur, indem wir Papiere schreiben lassen, die dann zur Kenntnis genommen werden. Alle müssen aktiv teilhaben am Prozess, um ihn auch mittragen zu können. Die, die es konkret betrifft, sollten das Evangelium durchbeten und gemeinschaftlich um Identifikation aus dem Glauben heraus ringen. Dann werden wir zu förderlichen und zukunftsfähigen Strukturen finden.
Und erst dann können solche Prozesse auch eine echte Fruchtbarkeit entwickeln. Die Kirche ist doch der Leib Christi; ein Organismus, der davon lebt, dass sich alle seine Glieder an seinem Aufbau beteiligen. Sonst ist dieser Leib krank, erstarrt und kapselt sich ab. Die dauerhafte Beschäftigung mit uns selbst tut niemandem gut. Die Zeichen der Zeit können uns dann nicht mehr in Anspruch nehmen.
Statt sie aus dem Evangelium zu deuten, verlieren wir uns in internen Debatten. Flagge für den Glauben können wir aber nur zeigen, wenn unsere Gemeinden sichtbar vom Evangelium inspiriert sind. Hoffnung und Ermutigung in von Krisen geschüttelten Zeiten sollten von uns ausgehen – und zwar an alle Menschen, die mit uns leben. Wir wollen uns doch nicht zuerst an unserer Selbsterhaltung abarbeiten, sondern selbstlos unsere Freude am Evangelium mitteilen.
DOMRADIO.DE: Bei #ZusammenFinden geht es angesichts schwindender Ressourcen eher um die Einsicht in die Notwendigkeit. Wie ließe sich eine solche Transformation kreativ gestalten, ohne dass das Eigentliche dabei zu kurz kommt?
Hammes: Selbst wenn der Glaube Berge versetzt, darf er die Realitäten nicht ignorieren. Auch die Kirche unterliegt globalen Megatrends, die sie selbst nicht in der Hand hat, geschweige denn aufhalten oder umkehren könnte. Eine wirklich geistliche Haltung lernt, das anzunehmen, ohne zu resignieren. Insofern ist völlig klar, dass die Ressourcen schwinden. Wir müssen mit dieser Entwicklung verantwortlich umgehen.
Wenn wir die Dinge einfach so laufen lassen, dann brechen sie vollständig zusammen und wir hinterlassen eigentlich nur verbrannte Erde. Das wäre fahrlässig. Vorsorge für die Zukunft nimmt die ureigene Verantwortung ernst. Andererseits aber sagt uns das Evangelium auch: Die Sorgen sollen uns nicht zerfressen und beherrschen. Es sollte uns also, wie Jesus es sagt, immer zuallererst um das Reich Gottes gehen. Das andere wird uns dazugegeben, damit wir uns nicht die ganze Zeit im Verwalten, Strukturieren und angstbesetztem Festhalten an dem, was noch irgendwie zu retten ist, verstricken.
Was aber soll eigentlich beim Prozess "Zusammenfinden" zusammenfinden? Geht es nur um die horizontale Ebene, dass bestimmte Gemeinden zur großen Einheit zusammenfinden? Oder muss nicht auch zusammenfinden, was uns geprägt hat, woran wir hängen und worin wir uns beheimatet fühlen?
DOMRADIO.DE: Was ist Ihre Sicht?
Hammes: Zusammenfinden muss neben den äußeren Verlusten an Mitteln und Mitgliedern auch, was schon lange nach innen verdunstet: die Weitergabe des Glaubens. Menschen tun sich schwer mit dem personalen Gott, immer mehr aber auch mit dem Katholischsein: mit der Lehre, den Formen und Ritualen. Vieles ist unverständlich geworden. Wir können nicht nur auf einer rein sachlichen Ebene der Notwendigkeiten miteinander ins Gespräch kommen. Wir haben auch sehr sensibel darauf zu schauen, was die Menschen konkret mitbringen an Sehnsucht und Erwartung, an Unsicherheit und Zweifel. Das alles gehört ja auch zu unserem Erbe.
Darüber hinaus gilt es, die Hierarchie der pastoralen Wahrheiten zu überprüfen. Wir können nicht agieren wie ein Konzern, der nach äußeren Effizienzkriterien, die eine Unternehmensberatung aufstellt, entscheiden. Wir können nicht zuerst schauen, was sich rechnet. Nach welchen Kriterien denn? Seit den Tagen Abrahams zeigt sich unser Gott als einer, der eben gerade nicht zählt, der sich in keine menschliche Bilanz zwängen lässt. Tut die Kirche es dennoch, verfällt sie an einen anderen Gott.
DOMRADIO.DE: Gibt es für die Beteiligten überhaupt Gestaltungsspielräume?
Hammes: Meines Erachtens sind die Möglichkeiten für die Engagierten zu eng gefasst. Die Grundentscheidungen sind letztlich alle schon von oben getroffen und sie werden flächendeckend für alle gleich angewandt. Ich persönlich habe nicht den Eindruck, dass dabei der Besonderheit der pastoralen Räume ausreichend Rechnung getragen wird.
Im Grunde gehen alle denselben Weg, was den individuellen Ausprägungen der Gemeinden nicht gerecht wird. Ich hätte mir einen Prozess gewünscht, der mit aufmerksamer Wahrnehmung dessen beginnt, was denn vor Ort gewachsen ist. Das meine ich mit „Erbe“. Äußere Daten allein genügen da nicht.
DOMRADIO.DE: Umfragen zeigen, dass die Menschen Ängste haben, angesichts immer größerer territorialer Einheiten ihre kirchliche Heimat zu verlieren. Wie lassen sich diese Ängste ernst nehmen?
Hammes: In soziologischen Erhebungen kristallisiert sich ganz klar heraus: Religiöse Bindung und Prägung entsteht allein durch den persönlichen Kontakt; nur er festigt und kultiviert Identifikation. Das beginnt klassisch bei dem Beispiel der Eltern und setzt sich fort in den Gemeinden vor Ort. Medieninitiativen leisten wertvolle Arbeit im Vorfeld, aber sie können die eigentliche Pastoral immer nur anbahnen und flankieren. Denn Seelsorge ist und bleibt Beziehungsarbeit, ihr Fundament belastbares Vertrauen.
Wir haben keine religiösen Produkte zu verkaufen nach marktgerechten Strategien. Flächendeckende pastorale Versorgung kann dabei nicht mehr unser Ziel sein, das schaffen wir ja schon heute nicht mehr. Besser ist es, an wenigen Orten ganze Arbeit zu leisten, als an vielen Orten nur halbe Sachen zu machen. Soll es in Richtung pastoraler Zentren gehen, müssen sie Orte einer echten Sammlung werden; Orte, die den Aufbau verlässlicher Beziehungen ermöglichen. Orte, wo nicht nur Service abgerufen wird, sondern Vertrauen wachsen kann.
Ängste lassen sich nicht dadurch nehmen, dass man sie klein redet. Es ist eben nicht so, wie ich neulich in einem Interview gelesen habe, dass wir jetzt nur die Strukturen ändern, aber in der Seelsorge alles so bleibt, wie es ist. Man muss ehrlich davon reden, was sich verändern muss, damit das Wesentliche möglich bleibt, und nicht scheibchenweise mit der Wahrheit herausrücken und dann die Leute überrumpeln. Transparente Kommunikation bleibt auch in der Kirche ein Dauerbrenner. Wie in der Politik vermissen die Menschen, gehört zu werden. Schlimmer noch: Jetzt gerade erleben sie, dass sie vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Und das schafft Angst und Enttäuschung.
DOMRADIO.DE: Was müsste mehr in den Fokus rücken?
Hammes: Echter Hirtendienst, wie Christus selbst ihn im Johannesevangelium entwirft, hebt darauf ab, dass die Schafe die Stimme ihres Herrn kennen und er auch um die Sorgen und Nöte der ihm anvertrauten Herde ganz genau weiß. Der gute Hirte kann nur führen, weil er um die weiß, die ihm anvertraut sind, sie radikal ernst nimmt. Zweitens ist er absolut verbindlich bis zur Hingabe seines Lebens. Auf sein Wort ist Verlass. Auch wir müssen verbindlich sein: Mein Ja ist ein ehrliches Ja und mein Nein ist ein verlässliches Nein.
Das ist das Urbild von Seelsorge, und das hat sich auch in 2000 Jahren bei all den gesellschaftlichen Umbrüchen nicht verändert. Aber genau das müssen Menschen dann auch weiterhin zu spüren bekommen, dass es um sie persönlich geht, dass sie uns Seelsorgern am Herzen liegen und wir uns einander vertraut machen. Nochmals: Das können wir nicht mehr flächendeckend leisten, aber wir sollten dafür sorgen, dass wir diesen Dienst da, wo wir zur Stelle sind, mit ganzer Kraft und ganzem Herzen auch leben.
DOMRADIO.DE: Kirche lebt von der Eucharistie. Doch der Messbesuch, um als Gemeinde zusammenzukommen und zu teilen, was einen bewegt, nimmt immer mehr ab. Und damit fehlt dann eine wesentliche Grundlage, um genau da in einen Dialog miteinander zu treten…
Hammes: Dass immer weniger Menschen einen Gottesdienst besuchen, hat vielfältige Gründe. Ein wesentlicher Punkt aber ist sicher die religiöse Entfremdung. Es fehlt der Bezug zu den überlieferten Ritualen. Ein explizit gelebter Glaube ist nur noch schwach verwurzelt. Die hohe Liturgie der Eucharistie aber setzt voraus, dass die Menschen eine elementare Gebetskultur pflegen, sie in ihren Alltag integrieren. Sonst bleibt sie ein abgehobenes Spiel.
Zu echter Wandlung kommt es aber oft auch aus einem anderen Grund nicht. Von den altehrwürdigen Riten mag eine objektive Wirkung ausgehen. Wenn die Menschen aber deren Bezug zum eigenen Leben vermissen, kommen sie subjektiv darin gar nicht vor. Dabei soll sich "Subjektives" und "Objektives" in der Eucharistie gegenseitig durchdringen.

Wir legen unser Leben symbolisch auf den Altar und empfangen es von dort neu und gewandelt zurück. Unsere Sorgen und Nöte, unser Versagen und Zweifeln, aber auch unsere Freuden, Erfolge, unsere Liebe und Hingabe können wir Christus übergeben. Doch die versammelte Gemeinde muss ihre Gaben auch wiederfinden können: im heiligen Geschehen, in der Verkündigung und im Gebet.
In der alten Kirche gab es eine ganz zwingende Verbindung zwischen Eucharistie und Agape. Da haben die Menschen wirklich das zum Leben Notwendige miteinander geteilt, dass jeder in seinen Nöten gemerkt hat, die ganze Gemeinde sorgt sich um mich – als unmittelbare Folge der Hingabe Christi in der gemeinsam gefeierten Eucharistie. An dieser Wechselwirkung zwischen Liturgie und Leben gilt es beständig zu arbeiten. Die Liturgie selbst sollte den Raum weiten für das, was die Menschen bewegt. Dann finden wir auch wieder zu einer sonntäglichen Agape für unsere Zeit.
DOMRADIO.DE: Mehr als früher stehen die Laien in der Verantwortung, auch pastoral tätig zu werden und das Gemeindeleben am Ort lebendig zu halten angesichts dieser immer größer werdenden Einheiten. Dafür aber muss ihnen auch etwas zugetraut werden. Schließlich soll Pastoral ermöglichen und ermächtigen…
Hammes: Dieses Begriffspaar erfreut sich offiziell großer Beliebtheit. Ihm entgegen steht ein anhaltendes Missverständnis von der hierarchischen Struktur der Kirche. Als ginge es hier primär um die Verteilung von Macht; als müsse unbedingt sichergestellt werden, dass der, der an der Spitze steht, alles in den Händen halten und alles unter seine Kontrolle bringen muss. Die Form der Hierarchie hat ihrem Inhalt zu entsprechen: der Treue zu dem Ursprung, dem heiligen Anfang, aus dem die Kirche hervorgeht. Dieser Ursprung ist der auferstandene Herr.
Christus hat seine Jünger mit seinem Geist befähigt, selber zu den Menschen zu gehen, das Evangelium zu verkünden und sogar in seinem Namen Wunder zu vollbringen. Sie sollten erfahren, dass seine Kraft auf sie übergeht. Das ist der biblische Ursprung. Ermächtigung also, um dem oft so verwundeten Leben zu dienen.
Laien dürfen sich daher heute nicht als Lückenbüßer für das erleben, was wir Kleriker nicht mehr schaffen. Dann werden weiterhin viele Charismen ungenutzt liegen bleiben. Der Herr aber schenkt sie seiner Kirche, damit sie Platz finden und sich die ganze Fülle des neuen Lebens entfalten kann. Ein leitender Pfarrer müsste dann gar nicht der permanente Vordenker und Dienstanweiser sein. Als Koordinator und Moderator hält er die Aufmerksamkeit für jedes Charisma wach und sorgt sich darum, dass es ins Spiel kommen kann.
Paulus nennt einmal die Gemeinde sein "Empfehlungsschreiben" vor Gott. Nicht weil alle in Reih und Glied nach seiner Vorgabe marschieren, sondern weil der Geist des Herrn in ihr weiten Raum bekommt. Dafür war er erfolgreicher Anwalt. Und so verstanden wird beides auch aneinander und miteinander wachsen: das allgemeine Priestertum aller Gläubigen und das besondere Priestertum der Geweihten.
Das Interview führte Beatrice Tomasetti